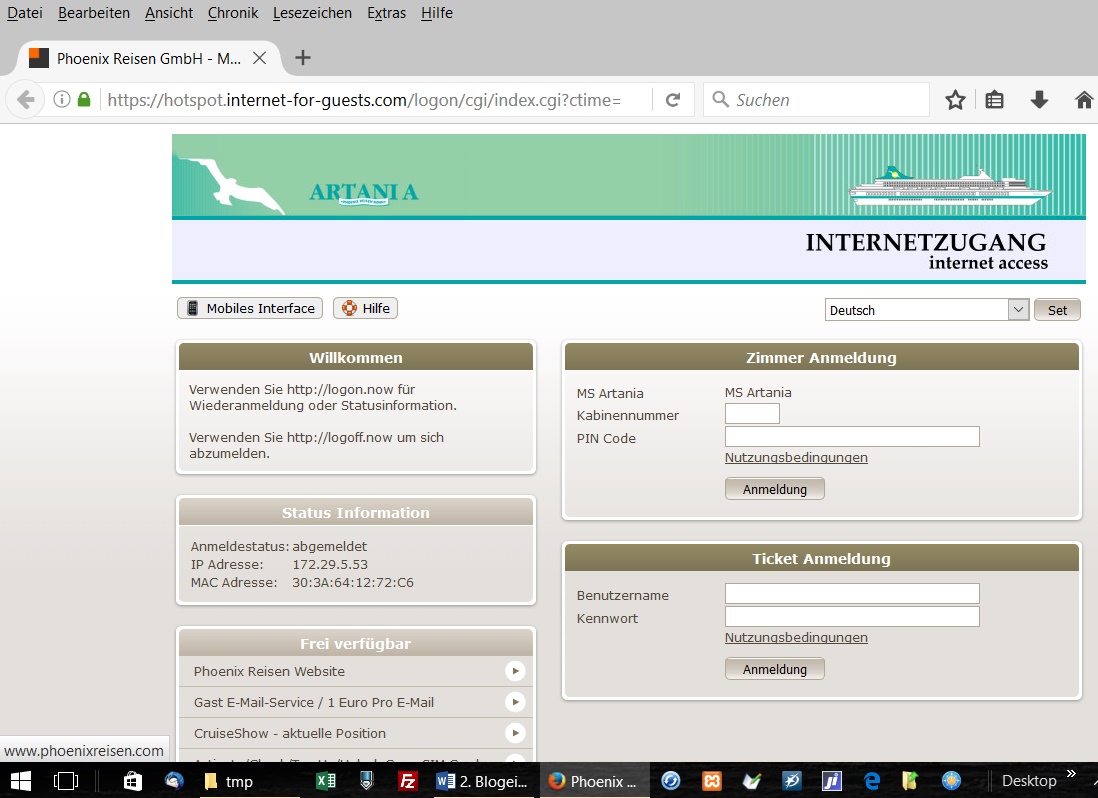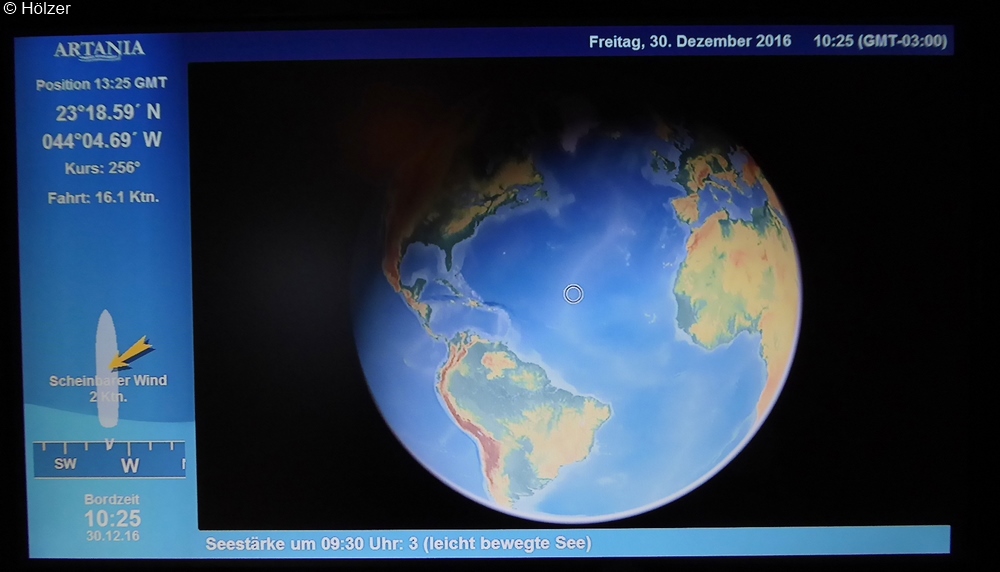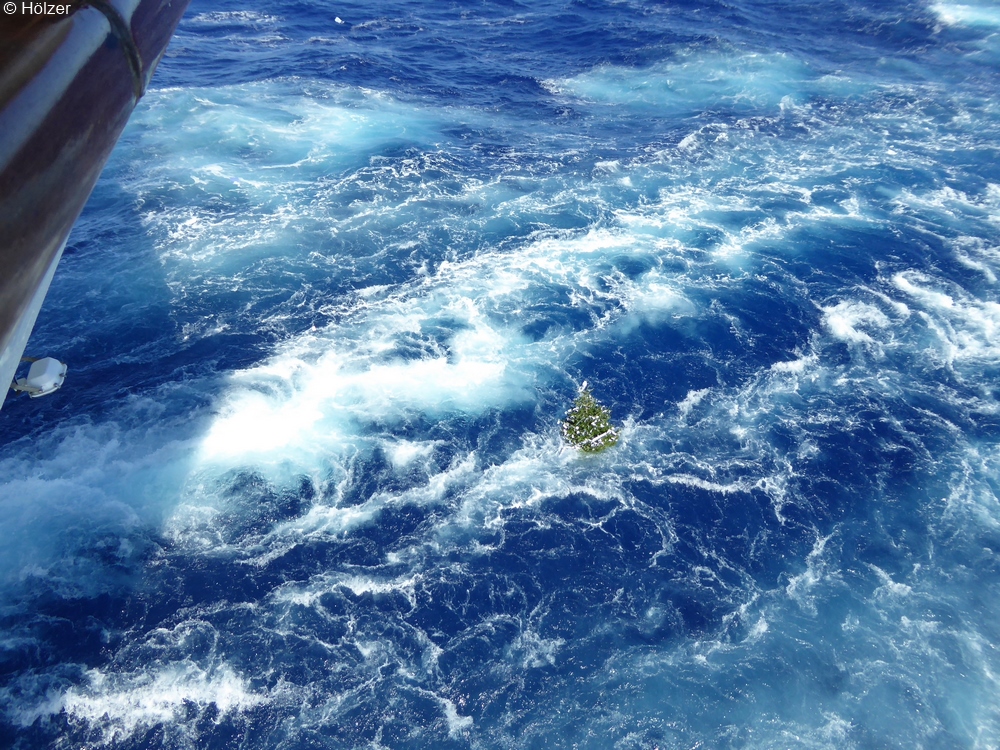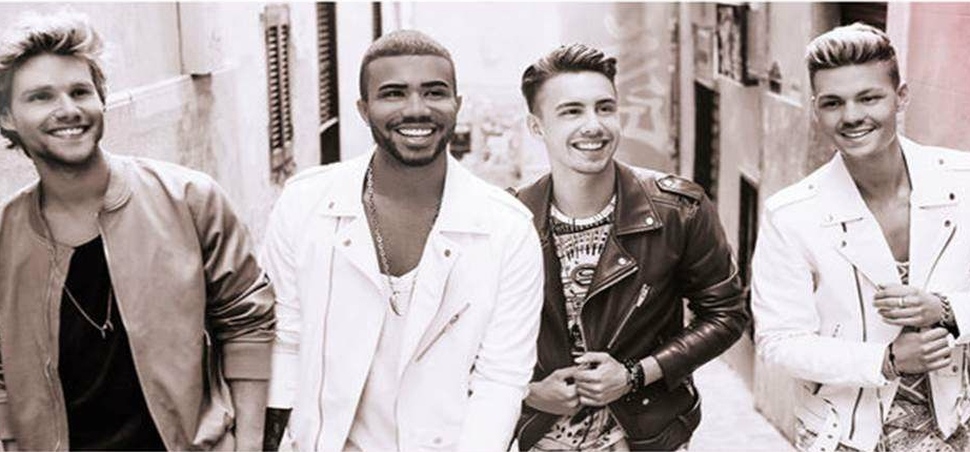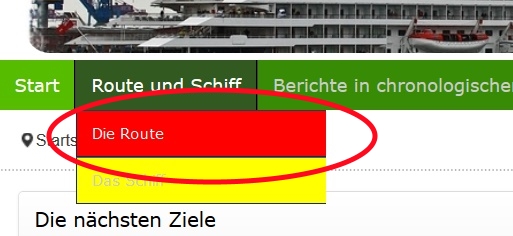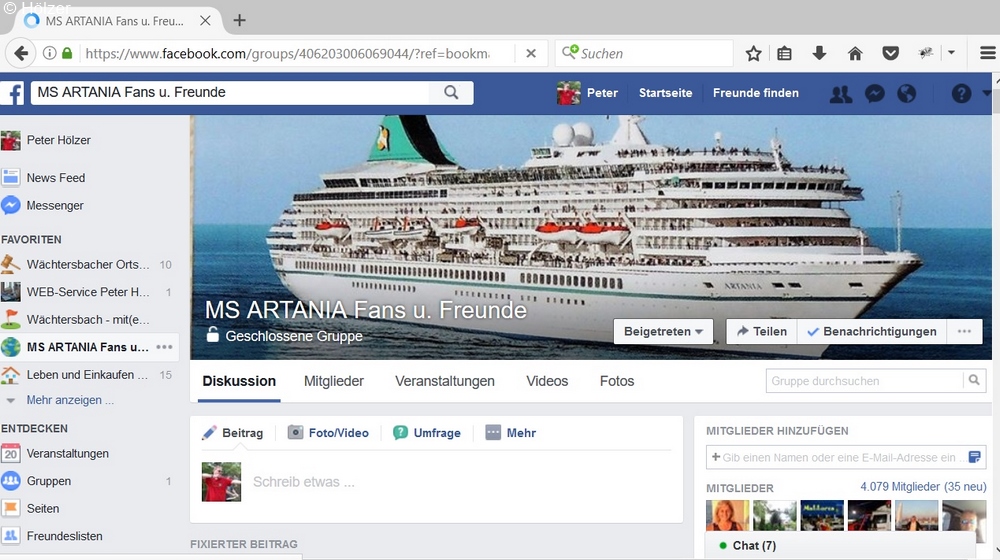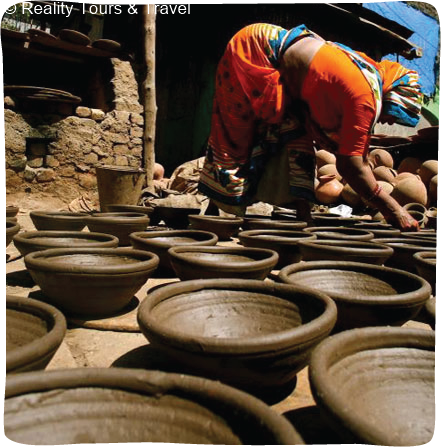Mit dem Schiff einmal um die Welt 
2016/2017 - Eine Kreuzfahrt mit der MS Artania
6.2.2015 bis 19.12.2016
Die erste Reisevorbereitung begann bereits am 6.2.2015 auf unserer Südamerika-Kreuzfahrt auf der Artania. Da hatten wir uns nämlich eine Option für diese Reise bei Phoenix-Reisen eintragen lassen. Gleiches Schiff und gleiche Kabine!
In April 2015, als wir wieder zu Hause waren, machten wir aus der Option eine feste Buchung.
Ende Oktober bekamen wir die Information, dass wir uns für folgende Länder Visa beschaffen müssen:
- Australien
- Sri Lanka
- Indien
Für alle anderen Länder würde der Reiseveranstalter Gruppenvisa beantragen, da brauchen wir uns selbst nicht kümmern.
Über die Hürden bei der Visabeschaffung für Indien hatte ich ja bereits in meinem Blog 2013 ausführlich berichtet. Wer möchte kann das hier noch einmal nachlesen.
Aber fangen wir mit etwas leichterem an – Sri Lanka, kostet nichts und geht online per Internet.
Nachdem ich also mühsam den Onlinefragebogen ausgefüllt hatte und die letzte Frage "Wann werden Sie einreisen" wahrheitsgemäß mit "am 12.4.2017" beantwortet hatte, kam aus den Tiefen des Internets die Antwort: "Das Visum kann frühestens 90 Tage vor der geplanten Einreise beantragt werden", also erst ab 12. Januar 2017, aber da sind wir irgendwo in Mittelamerika.
Naja, Phoenix-Reisen hat dann schließlich eingesehen, die sie Visa für uns beschaffen und diese dann irgendwie aufs Schiff beamen müssen.
Australien bietet gefühlte 150 verschiedene Visatypen an, aber mit der Information des Reiseveranstalters, dass dieses kostenlos sei, war die Auswahl schon geringer. Davon gab es nämlich nur ein einziges Modell. Ratzfatz hatte ich für Doris das entsprechende Online-Formular ausgefüllt und erhielt postwendend per Mail das Visum als PDF-Datei.
Nach der Eingabe meiner Daten erhielt ich erst einmal nichts außer einer Bearbeitungsnummer. Erst nach 10 Tagen stillen Bangens und Hoffens kam dann letztendlich auch per Mail mein Visum für Australien.

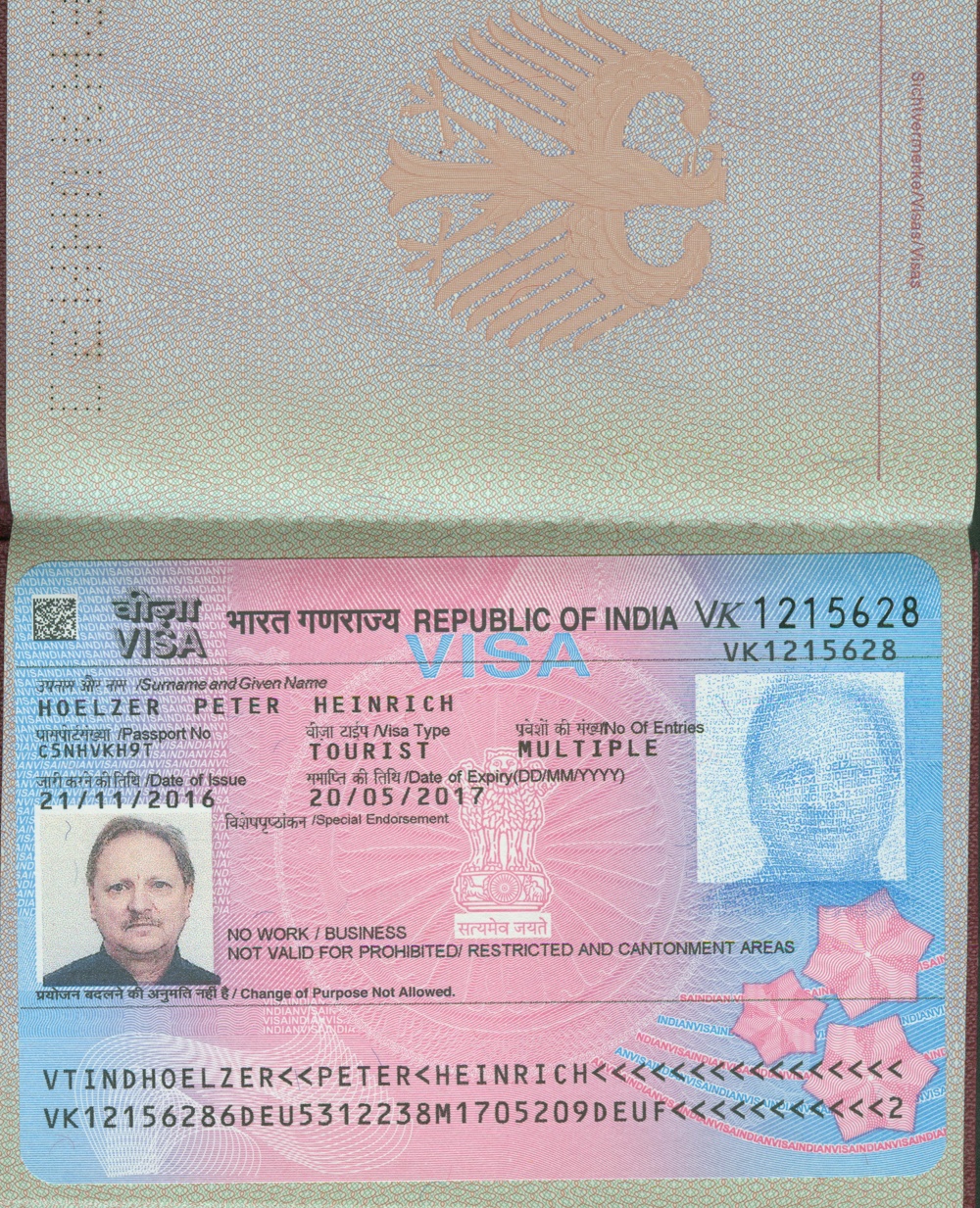
Die Visa für Indien stellten hingegen gar kein Problem dar. Mit unserem Know-How aus Dezember 2012 und noch im dem Besitz von den erforderlichen Passbildern im exotischen Format 5cm x 5cm brachte ich persönlich die ausgefüllten Formulare, unsere Pässe und 65 Euro pro Antrag (also 130 EUR) aufs indische Konsulat nach Frankfurt.

Einige Tage später konnten wir unsere Pässe mit den dort eingeklebten Visa wieder abholen. Und da wir nun mal schon in Frankfurt waren, machten wir noch einen Abstecher auf den dortigen Weihnachtsmarkt.
Anfang Dezember kam der unangenehmste Teil der Reisevorbereitungen. Die Restzahlung an Phoenix-Reisen war fällig.
Im Laufe des Jahres hatte ich bereits die neue WEB-Seite für den Reiseblog aufgebaut und Reiseroute und Schiffsbeschreibung eingebaut.
Zur Reiseroute haben Mitglieder des Internetportals http://www.kreuzfahrtinfos.at/forum/ für mich wunderschöne Routenkarten für die einzelnen Etappen angefertigt. Ein Blick in die Menüpunkte unter "Route und Schiff", insbesondere der Unterpunkt "Die Route" ist durchaus lohnenswert.
Irgenwann kam ja auch noch das Problem des Kofferpackens unbarmherzig auf uns zu. Für den Flug nach Mailand, wo der Transferbus nach Genua auf und warten wird, genehmigt uns die Lufthansa 30 Kg Freigepäck pro Person. Das ist ein wenig knapp.
Also packten wir für Tefra einen großen schweren Koffer, der am 16. Dezember, wie angekündigt, von einem Kurierfahrer abgeholt wurde. Nachdem ich den Koffer dem Kurierfahrer ausgehändigt hatte, fragte ich vorsichtig nach einer Quittung. "Nö, so was sei nicht vorgesehen, er habe ja auch gar keinen Quittungsblock." meinte der Fahrer und versicherte mir aber, dass der Koffer ganz bestimmt ankommen wird. Gnädigerweise gestattete er mir, das Display sein elektronisches Geräts, in dem die Abholaufträge hinterlegt sind, abzufotografieren.
Trotzdem habe ich es mir nicht nehmen lassen, per Fax den Geschäftsführer von TEfra aufzufordern, mir schriftlich den Empfang des Koffers zu bestätigen, was er dann auch brav gemacht hat. Ich hatte aber nicht den Eindruck, dass in Zukunft die TEfra-Kurierfahrer mit Quittungsblöcken ausgestattet werden.
Fazit: Quittungen sind ausschließlich Chefsache!
Irgendwie haben wir es dann auch geschafft, die Koffer zu packen mit Klamotten, Schuhen, Waschzeug, riesen Hausapotheke, viel Computer-Zeugs und sonstige Technik und vier Dosen hessische Wurst. Gemäß den Lufthansabestimmungen, darf kein Koffer schwerer als 23 Kg sein, d.h. für die zulässigen 30 Kilo braucht jeder zwei Koffer. Zusammen mit dem TEfra-Koffer (30 Kg) und dem Handgepäck kommen wir locker auf über 100 Kg.
20.12.2016
Was mir an dieser Reise ein gewisses Unbehagen bereitet, ist, an Weihnachten nicht zu Hause zu sein. Das war in meinen letzten 62 Jahren bisher noch nie der Fall.
Gestern wurde die Weihnachtsdeko noch abgebaut und zwecks Bewahrung der traditionellen Rituale haben wir am Abend vom Festplattenrecorder den Spielfilm "Der kleine Lord" angeschaut, denn ich hatte in weiser Voraussicht den Film im letzen Jahr aufgezeichnet. Denn wenn wieder der Film in diesem Jahr am 23.12.2016 (übrigens mein Geburtstag) im Fernsehen läuft, sind wir längst auf See. Und "Der Kleine Lord" wurde schon immer geguckt, obwohl wir alle Dialoge schon auswendig mitsprechen können.
Für den Reiseblog habe ich diese Zeilen jetzt fast fertig geschrieben.
Mal sehen was die Reise uns für Erlebnisse und kleine Abenteuer bescheren wird, auf große Abenteuer möchten wir lieber verzichten.
Viele konkrete Pläne für die Landgänge haben wir nicht. Einige Ausflüge haben wir schon gebucht, z.B.
- eine Überlandfahrt auf Madeira,
- Führung auf den Osterinseln,
- Schnorcheln auf Bora Bora,
- Beobachtungen der Komodowarane auf Komodo (Indonesien),
- Reisterassen auf Bali und
- eine Tour durch Mumbai mit privatem Führer, die wir über das Internet gebucht haben.
Den Rest lassen wir auf uns zukommen. Man bekommt ja auch noch diverse Informationen zu jedem Zielhafen an Bord durch Vorträge der Reiseleiter und verschiedenen Lektoren.
Morgen um 9:30 Uhr kommt das Taxi und dann wird es etwas dauern bis ich mich wieder hier im Blog melde. Am 24.12 in Cadiz/Spanien wird noch nicht so viel Berichtenswertes angefallen sein. Zwei Tage später auf Madeira machen wir ja einen Ausflug, da bleibt keine Zeit zur Suche eines Internetcafes, um den dort den Blog zu aktualisieren und dann geht es ja schon über den Atlantik und die Atlantiküberquerung wird 6 Tage dauern.
Also irgendwo aus der Karibik gebe ich wieder laut.
Auf dwer Phoenix-Seite http://www.phoenixreisen.com/hier-ist-die-artania-heute-.html?page=1 kann man jederzeit sehen, wo sich die MS ARTANIA gerade befindet.
In der Zwischenzeit, liebe Leserinnen und Leser, können Sie ja, falls sie Langeweile haben, hier etwas ins Gästebuch schreiben.
.... Ich bin dann mal weg!
001. Reisetag - Mittwoch, 21.12.1016 Anreise nach Genua
Die Anreise verlief problemlos, der Flieger nach Mailand hatte lediglich 30 Minuten Verspätung und jeder von uns hätte statt der von Phoenix angegebenen 30 Kg Gepäck sogar 43 Kg mitnehmen können Diese Irritation gab es auch schon 2015 bei unserer Südamerikareise. Phoenix schreibt 2 Gepäckstücke in Summe nicht mehr als 30 Kg, aber ein einzelner Koffer nicht mehr als 23 Kg wiegen.
Lufthansa hingegen hat die Regel: „Bei Flüge innerhalb Europas ist ein Gepäckstück mit max. 23 frei.“ Ein 30-Kg-Limit ist bei Lufthansa unbekannt. Und wenn auf dem Ticket „2 Gepäckstücke frei“ draufsteht, sind eben 2x23Kg frei. Genau so muss wohl der Lufthansa-Computer beim Einchecken denken. Blöd ist nur, dass einem weder bei Lufthansa noch bei Phoenix diese Denke verbindlich bestätigen kann. Deshalb blieb der mitgenommene Wurstvorrat auf 4 Dosen hessischem Presskopf und Mettwurst beschränkt.
In Mailand ging es weiter per Bustransfer nach Genua. Bei der gut zwei stündigen Fahrt kamen wir an Örtchen vorbei, wo man erwarten konnte, dass sich jederzeit Don Camilo und Pepone auf dem Platz vor der alten Kirche begegnen könnten, die Kulisse absolut identisch wie in den alten Schwarzweiß-Filmen aus den 50er und 60er Jahren.
Auch das Einchecken im Hafenterminal in Genua ging schnell und problemlos von statten, wir wurden fotografiert und unser Konterfei wurde auf eine Bordausweis gedruckt, der uns ab sofort berechtigte, die Artania zu betreten.
Auf dem Schiff, am Ende der Gangway, begrüßte der aus der Fernseh-Doku-Soap „Verrückt nach Meer“ vielen bekannte Kreuzfahrtdirektor Thomas Gleiss die Neuankömmlinge herzlich mit dem Phoenix-Slogan: “Willkommen zu Hause“. Täuschte ich mich oder war es nur Zufall, dass er uns nicht begrüßte, sondern nur darauf hinwies, dass wir „da rechts beim Kollegen“, die Einlasskontrolle passieren könnten. Herr Gleiss ist in meinem Südamerikablog nicht so gut wegbekommen. Hat er etwa den Blog und insbesondere den entsprechenden Abschnitt gelesen? ( www.2015a.pehoelzer 12. Blogeintrag, 79. Reisetag ).
Dafür wurden wir ganz besonders herzlich von Caroline begrüßt, die auf der Südamerikareise unsere Kabinenstewardess war und uns sofort wiedererkannt hatte, als wir ihr zufällig über den Weg liefen. (Unser jetziger Kabinensteward ist Ruel).
Auch zwei Ehepaare, die wir von besagter Südamerikareise kannten, konnten wir „Guten Tag“ sagen. Ebenso begrüßte uns Frau Dr. Maurer, die Ärztin, die damals Doris‘ gebrochenen Arm zusammen mit ihren Kollegen Dr. Koller wieder zusammen getackert hatte.
Nach der obligatorischen Seenotrettungsübung, die sich wieder mal wie Kaugummi in die Länge zog, legte das Schiff gegen halb acht endlich ab. Grandiose Kulisse - Genua liegt in einem engen Talkessel und die Stadt zieht sich an den nahen Berghängen hoch und da es bereits dunkel ist, sorgen die Lichter für die entsprechende Stimmung bei der Ausfahrt.
Hinter uns die immer kleiner werdende Bucht von Genua, vor uns das offene Meer und die Gewissheit eine Fahrt um die gesamte Erdkugel vor sich zu haben - Gänsehaut!
002. Reisetag - Donnerstag, 22.12.1016 Seetag
Die Sachen aus dem Koffer ausgepackt und irgendwo in der Kabine verstaut, aber die Ordnung ist nicht optimal. Es wird noch Tage dauern, dass man die Sachen, die man des Öfteren braucht, auch gut griffbereit zu finden sind und sich nicht irgendwo ganz hinten im Schrank oder in der untersten Schublade (fast auf Fussbodenhöhe) verstecken.
Das Fitnessstudio hat sich auch nicht verändert und nach dem Frühstück wird geht es erst einmal auf das „Fahrrad mit Meerblick“.
Im "Jamaica Club", hinter diesem exotischen Namen verbirgt sich lediglich, das Spielezimmer, verfasse ich meine ersten Zeilen für den Blog. Im Spielezimmer trifft man sich hauptsächlich um Skat, Rummicub oder Ähnliches zu spielen. Der Vorteile dieser Location sind die normalen Stühle und Tische. Die anderen Gesellschaftsräume sind hauptsächlich mit Clubsesseln und Cocktailtischchen ausgestattet, für die Arbeit am Laptop also absolut ungeeignet.
Als ich also so vor mich hin arbeitete, sagte jemand zu mir: “Sie sind doch der Peter Hölzer.“. Der mir gänzlich unbekannte Herr nebst Gattin entpuppte sich als ein Leser meines Südamerikablogs und besagte Gattin verriet mir, dass er, der Gatte, öfters erst seht spät ins Bett gekommen sei, da er noch am Computer mit Blog-Lesen beschäftigt war.
Bin ich jetzt berühmt? Komm‘ ich jetzt ins Fernsehen? Sicher nicht! Aber es ist natürlich schön zu wissen, dass es dennoch Leute gibt, die sich für mein Geschreibsel interessieren.
Für den Abend wurde die erste Gala der Reise angesetzt. 18:00 Uhr: Shake Hands mit dem Kapitän, anschließend Sekt und Vorstellung der Offiziere, am Abend Galadiner. Über Galas hatte ich mich ja schon oft und ausgiebig in früheren Blogs ausgelassen, meist spöttisch und ironisch. Aber viele Menschen legen darauf großen Wert, schmeißen sich auch richtig in Schale und haben Freude daran. Und mit der Kölner Philosophie: „Jeder Jeck ist anders“ haben sowohl die Gala-Befürworter als auch die Gala-Verweigerer ihre Daseinsberechtigung.
Und wir selbst haben uns dem Anlass gemäß ordentlich gekleidet, am Abend in das Lidorestaurant begeben, ohne dass wir uns vorher vom Kapitän begrüßen haben lassen.
Beim Lido handelt es sich um ein Buffet-Restaurant. Es gibt dort dieselben Speisen wie im großen Restaurant, wo das Menü stilvoll serviert wird, nur eben per Selbstbedienung.
003. Reisetag - Freitag, 22.12.1016 Seetag
Seetage kann man ruhig angehen. Nach dem gemütlichen Frühstück ging es erst mal in den Fitnessraum. Ohne Zeitdruck war man dann bereit für den Höhepunkt des Tages.
11:oo Uhr „Weihnachtsfrühshoppen auf dem MS Artania Fischmarkt“.
Es ist wirklich nicht einfach, auf einem Kreuzfahrtschiff bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen von knapp 20 Grad weihnachtliche Stimmung zu verbreiten. Aber Frau Gleis-Wiedemann (Gattin vom Kreuzfahrtdirektor Gleis und Leiterin des Artania-Show-Ensembles) tat ihr Bestes. Im Schulterfreien Nikolauskleid sang sie wirklich gekonnt und mit Inbrunst „Best Of Christmas Songs“, angefangen von White Christmas über Rudolph The Red Nose Rendeer und Santa Baby war alles dabei, während Shrimps satt, diverse Fische, Matjes und Heringssalat angeboten wurde. Auch ein Doppelkorn war gratis, während der Glühwein mit 2,50 Euro zu Buche schlug, der aber wegen der milden Temperaturen nicht besonders zum Umsatz beitrug.
Eine beliebte Freizeitbeschäftigung auf Kreuzfahrtschiffen ist das Spiel „Bingo“. Man zahlt 5 Euro, erhält eine Karte voll mit Zahlen. Dann werden aus einer Art Lotto-Trommel nacheinander Zahlen gezogen, solange bis jemand genügend Übereinstimmungen mit den Zahlen auf seiner Karte hat. Derjenige ruft „Bingo“ es wird geprüft, ob die Zahlen tatsächlich übereinstimmen und dann hat man die Einzahlungen sämtlicher Mitspieler gewonnen.
Auch Doris wollte so die Urlaubskasse aufbessern, während ich wieder mit Blog-Schreiben beschäftigt war.
Nach der Bingo-Veranstaltung kam sie zurück und hatte doch tatsächlich einen Sonderpreis gewonnen, nämlich den für die schlechteste Bingokarte, d.h., die mit den wenigsten Treffern aus der gesamten Bingo-Community - eine Flasche Sekt (Hausmarke).
Der Abend verlief ohne weitere Höhepunkte. Zwar hätte mir heute ein Ständchen nach dem Abendessen zugestanden, dargeboten von musikalischen Kellnern mit gleichzeitiger Überreichung einer Torte, denn ich hatte Geburtstag (63.). Aber aus vielen Beobachtungen solcher Zeremonien wussten wir, dass es unmöglich ist, die Torte trotze Einladung aller erreichbaren Tischnachbarn vollständig wieder los zu werden, denn die meisten Leute haben nach einem reichlichen Dinner keine besondere Neigung mehr auf Buttercremetorte.
02. Blogeintrag 24.12.2016 - 01.01.2017
004. Reisetag - Samstag, 24.12.2016 (Heiligabend) Cádiz
Noch vor 8:oo Uhr erreichen wir Cádiz. Allerdings hatten wir es mit unserem Landgang jetzt nicht supereilig, da wir diese spanische Hafenstadt schon des Öfteren besucht hatten, zuletzt vor zwei Jahren auf unserer Südamerikareise.
Gleich am Hafenterminal gab es freies WLAN, was wir natürlich sofort genutzt haben. Mein kleines 10-Zoll Netbook hatte ich, wie meist, im Rucksack dabei. es gab auch Stühle, allerdings keine Tische, sodass man mit dem Netbook auf den Knien balancieren musste, aber dafür war das Netz sehr flott und es konnten sehr schnell die E-Mails abgerufen werden und der 1. Blogeintrag ging ins Netz.
Wir spazierten über die Plaza de San Juan de Dios an der Kathedrale (Catedral Nueva) vorbei, die Uferpromenade entlang zum Castillo de San Sebastián. Dieses alte Kastell ist in Meer gebaut und über einen geschätzt 400 -500 Meter langen Damm mit dem Ufer verbunden. Beim Letzten Besuch hatten wegen eines starken kalten Windes auf einen Besuch verzichtet, was wir jetzt prima nachholen konnten.
Nach dem touristischen Teil mussten wir noch einkaufen. Auf dem Einkaufszettel standen Mineralwasser, Kleiderbügel und Olivenöl stand. Die Sinnhaftigkeit für den Erwerb von Wasserliegt auf der Hand. So kostet der Liter auf dem Schiff 3,85 € und im Laden wenige Cent.
Wozu Olivenöl? Dazu vielleicht später mehr, wenn mal nichts Besonderes zum Berichten ansteht.
Die Kleiderbügel waren deshalb von Nöten (Stichwort: Breezing Ordering), weil im Kleiderschrank auf der Kabine mehr Platz zum Hängen als zum Stapeln ist, wir schon vom Kabinensteward 5 zusätzliche Bügel geordert hatten und uns nicht trauten ihm weitere zehn Stück aus seinem Fundus abzuringen.
Zwar kam an diesem Morgen noch keine Weihnachtsstimmung auf, aber im Supermarkt, wo wir einkauften war der Teufel los, sodass wir zumindest in den Genuss des üblichen Weihnachsstress kamen.
Um 18:00 Uhr legte das Schiff ab, und das Programm für den Heiligen Abend kam ans Laufen.
Man muss sagen, dass Angebot war so gestaltet, dass sich jeder Gast individuell seine Dosis Weinachten abholen konnte.
Das Angebot:
| 17.00- 18.00 | Foyer | Heißer Glühwein |
| 18.00 -20.30 | Resthaurants | Weihnachtliches Abendessen |
| 20.30 | Cassablanca Bar | Duo „Two for you“ unterhält Sie mit Weihnachtsliedern aus Jazz, Pop und Rock |
| 20.30 - 22.30 | Harry’s Bar | Klassische Weihnachtslieder spielt Ihr Pianist Vitaly Shatov |
| 20:30 | Pazifik-Lounge | Everergreens und Tanzmusik spielt für Sie die Impression Band |
| 21.00 - 22.30 | Atlantik-Show-Lounge | Christmas arround the World - Besinnliche Weihnachten |
| 21.15 | Bordkino | Noel (Spielfilm) |
| 23.15 | Atlantik-Show-Lounge | Christmette |
| 22.30 - 23.30 | Harry’s Bar | Käse-Fondue |
| 23.30 | Pazifik-Lounge | Weihnachtsdisco mit DJ Erik |
Wie wir aus Insiderkreisen erfuhren, hat der Reiseveranstalter das Problem, dass sich die Leute beschweren, die einen über zu wenig Weihnachten und andere über zu viel Weihnachten. Es sind in der Tat viele Alleinreisende, die auf der Kreuzfahrt der Einsamkeit entfliehen wollen, die sie zu Hause gerade am Heiligen Abend spüren würden. Und wie wir fanden, ist der Mix von Weihnachten/Nicht-Weihnachten gelungen.
Nach dem Abendessen, wir wählten den Klassiker, Würstchen und Kartoffelsalat, verbrachten wir den Abend in Harry’s Bar, wo der Barpianist für weihnachtliche musikalische Hintergrunduntermalung sorgte. Zwischendurch kiebitzen wir ab und an bei der Weihnachtsgala in der Atlantik Lounge, das ist der „Große Saal“ in dem die abendlichen Shows stattfinden. Hier traten im Rahmen der Gala sowohl Künstler vom Showensemble als auch musikalische Crewmitglieder auf, der Weihnachtsmann verteilte Geschenke (die man vorher bei ihm abgeliefert hat) und es wurde Besinnliches vorgelesen.
Zum Finale wurde zunächst von verschiedenen Solisten „Stille Nacht“ in den verschiedensten Sprachen gesungen, wobei zum Schluss zusammen mit einem Chor aus Schiffoffizierinnen und Offizieren alle drei deutsche Strophen gesungen wurden, ein wirklich gelungener emotionaler Höhepunkt der Gala.
Ich war vom Tag geschafft und ging ins Bett während Doris noch die Christmette besuchte. Am Vortag wurde wie gewöhnlich, das Tagesprogramm für den Folgetag ausgeteilt. Selbiges ließ aber offen, ob es sich bei der Christmette um einen katholischen, evangelischen oder ökumenischen Gottesdienst handeln würde. Deshalb fragte Doris bei der Dame an der Rezeption nach. Diese wusste es zwar auch nicht ganz genau, war sich aber ziemlich sicher, dass zurzeit an Bord ein ökumenischer Pfarrer sei. Donnerwetter, damit war die Artania ihrer Zeit Jahrzehnte wenn nicht Jahrhunderte voraus, hoffentlich Vorbild und Ansporn für unsere beiden großen Religionen in Deutschland.
Es stellte sich schließlich heraus, dass der Bordpfarrer zur evangelischen Fraktion zählte und vorhatte, einen ökumenischen Gottesdienst abzuhalten.
Fazit:
Man hatte sich wirklich alle erdenkliche Mühe gemacht, überall auf dem Schiff war es sehr schön und geschmackvoll geschmückt, in mehrerer Etappenwaren kleine Überraschungen in der Kabine vorzufinden, erst ein bunter Weihnachtsteller, dann ein kleines Lebkuchenhaus und schließlich noch 2 Schokoladennikoläuse in unserer Kabine. Trotz alledem kam nie die Stimmung und Empfindung auf, die man am Heiligen Abend zu Hause hat.
005. Reisetag - Sonntag, 25.12.2016 (1. Weihnachtsfeiertag) Seetag
Ich saß am Vormittag wieder mal im Jamaica-Club um für den Blog zu arbeiten. Hier hat auch Sayed, ein Mitarbeiter von Phoenix einen Schreibtisch stehen, hinter dem er sitzt, wenn er seine Sprechstunden, meist 2 x am Tag für jeweils eine Stunde, für die Silber- und Goldpassagiere abhält. Silber- und Goldpassagiere sind diejenigen Mitreisenden, die eine Balkonkabine, also eine gehobenere Kabinenkategorie, gebucht haben. Die meisten Fragen der Gäste betreffen allerdings nicht die „klassischen Themen“ wie Beschwerden, Fragen zum Schiff etc., sondern drehen sich zu 95% um das (kostenpflichte) Schiffs-WLAN im Allgemeinen und den Empfang und das Versenden von Emails im Besonderen. Zwar gibt es ein eng beschriebenes DinA4-Blatt mit einer technischen Beschreibung und Anleitung, aber damit kommen viele Passagiere nicht mit zurecht.
Also erklärt Sayed jedem einzelnen Frager, der mit seinem Smartphone oder Laptop bei ihm auf der Matte steht mit einer Engelsgeduld immer wieder, wie es funktioniert, was es kostet, wie man ein Datenkontingent kaufen kann … und und und.
Jetzt wurde als besonderer Service eine (einmalige) Spezialsprechstunde (auch für Holzklassenpassagiere) eingerichtet, nur zum Thema „Internet“. Der Jamaica-Club war deshalb rappelvoll. Viele Leute hatten gehofft, dass ein Vortrag gehalten wird, der die Technik etwas näher und verständlicher erläutert. Aber es gab nach wie vor nur die individuelle Einzelberatung, was zur Bildungen einer Warteschlange bestehend aus den angepilgerten Fragestellern führte, aus der heraus die ein oder andere Unmutsäußerunge zu hören war.
Ein guter Vortrag mit Beamerprojektionen von Screenshots der Anmeldevorgängen, dem speziellen Phoenix-Online-Formular, Systemmeldungen etc. im Bordkino, gepaart mit verständlichen Erläuterungen wäre in der Tat sinnvoller, effektiver und weniger nervig gewesen, sowohl für den Berater selbst, als auch für die Frager.
Man bedenke, jede neue Etappe der Reise bedeutet auch eine große Anzahl neuer Passagiere, und es startet wieder genau derselbe Fragemarathon.
Armer Sayed!
Nachdem Abendessen summt es im Foyer wie in einem Bienenschwarm. Dutzende von meist philippinischen Servicekräfte den großen Weihnachtsbaum und machten Fotos in allen möglichen Konstellationen; Gruppenfotos, Fotos zu dritt, zu zweit und solo. Was lernen wir daraus? Auf den Philippinen ist der 25.12 der Weihnachtstag und nicht wie bei uns der 24.12.
006. Reisetag - Montag, 26.12.2016 (2. Weihnachtsfeiertag) Funchal/Madeira (Portugal)
Für den Vormittag hatten wir einen Ausflug gebucht, da wir die City von Funchal schon ganz gut kannten, da wir hier schon zweimal waren.
Die Phoenix-Ausflugsbeschreibung las sich wie folgt:
Câmara de Lobos und Cabo Girão (ca. 4 Std; Preis 25,-€)
Ihre Fahrt entlang der Südküste Madeiras führt sie zunächst zum malerischen Fischerdorf Câmara de Lobos, das einst von Sir Winston Churchill auf Gemädeleinwand verewigt wurde. Nach einem kurzen Aufenthalt fahren Sie zum Cabo Girão, dem zweithöchsten Kap der Welt (580 m). Von hier aus haben Sie einen wunderbaren Blick auf die gesamte Bucht von Funchal und tief hinab über den Rand des Kliffs. Die Rückfahrt nach Funchal erfolgt mit Fotostopp am Aussichtspunkt Pico dos Barcelos.
Leser meiner früheren Blogs kennen meine Skepsis organisierten Ausflügen gegenüber, aber dieser Trip war OK. Die zugestandenen „Freizeiten“ an den Fotostopps waren ordentlich bemessen, nicht zu knapp und nicht zu lang. Die angelaufenen Punkte warensehenswert und die Leute waren sehr diszipliniert und haben beim Ein- und Aussteigen im Bus fast gar nicht gedrängelt.
Interessant war die Glasbodenplattform am Cabo Girão. Es kostete schon ein wenig Überwindung, sich der Glasplatte anzuvertrauen unter der es fast 600 Meter freier Fall zu drohen schien.
In Funchal statten wir dem Weihnachtsmarkt, der im Gegensatz zu den deutschen Märkten auch noch einige Tage nach Weihnachten weiter betrieben wurde, noch einen kurzen Besuch ab und pünktlich zum Mittagessen gegen 13:00 Uhr brachte und der Bus zurück zum Schiff.
Nach dem Mittagessen ging ich noch mal kurz von Bord, um in einer Cafebar im Hafenterminal einen Cappuccino zu trinken. Dann als Gast kam man in den Genuss des Internetzugangs. So konnte ich via Facebook dem Rest der Welt schon mal meine Wünsche fürs neue Jahr entbieten. Für alle Fälle hatte ich auch die beiden Schokoladeweihnachtsmänner aus unserer Kabine mitgenommen und die beiden Damen hinter dem Tresen der Cafebar hatten sich sehr darüber gefreut und ich war froh die beiden Kameraden sinnvoll entsorgt zu haben, denn an Dickmachern mangelt es uns auf dem Schiff ja keinesfalls.
Um 17:00 Uhr legte das Schiff ab, gleichzeitig mit der MS Albatros, ein weiteres Schiff der Phoenix-Flotte, das ebenfalls in Funchal lag und ebenso über den großen Teich wollte. Für einige Seemeilen fuhren die Schiffe nebeneinander, die Kapitäne konnten dabei nach Herzenslust die Nebelhörner tuten lassen und die Passagiere winkten sich auf den Außendecks zu.
Das Auslaufspektakel wurde mit einer Austernparty angereichert, allerdings waren schon nach kürzester Zeit die Austern aus und es gab nur noch Butterbrote mit Schnittlauch. Sehr getroffen hat uns dieser Engpass nicht, wir mögen keine Austern, und ein Gläschen Sekt konnte ich noch ergattern.
007. Reisetag - Dienstag, 27.12.2016 Seetag
Am Vormittag geriet ich zeitmäßig etwas in Stress.
- 8.00 Uhr Frühstück
- 9.00 Uhr Fitnessraum
- 10.00 Uhr Vortrag* - „Zeit und Kalender – ein Vortrag zum Jahreswechsel“*
- 11.00 Uhr Schreiben am Blog im Jamaica-Club
Der Rest des Tages wurde zum Stressabbau genutzt.
Die Geschichte unseres Kalenders, Julius Cäsar und Gregor, der islamische Mondkalender, Weihnachts-und Osterdatum, der Stern von Bethlehem, Nikolaus und der Osterhase, Gedanken zur Zeit, die Millenium-Diskussion, Napoleon und Kaiser Wilhelm.
Ein Vortrag Ihres Lektors Prof.Dr. Erich Übelacker in der Atlantik Show-Lounge / Deck 3.
Dieser Vortrag wird auf Kanal 10 im Bordfernsehen übertragen.
008. Reisetag - Mittwoch, 28.12.2016 Seetag
Hacken bei Phoenix leicht gemacht

Wenn diese beiden Lästermäuler - Statler und Waldorf aus der Muppetshow - hier im Blog auftauchen, heißt das, der Blogger hat etwas zu meckern.
Um auf dem Schiff Zugang zum Internet zu bekommen, bietet Phoenix ja diverse Datenpakete und Flatrates zu Preisen zwischen 15,00 € und 699,00 €. (siehe auch Blogeintrag vom 25.12.2016). Um solch ein Paket zu erwerben meldet man sich im Schiffs-WLAN an und zwar mit der Kabinennummer und einem vierstelligen persönlichen PIN-Code, der auf dem Bordausweis aufgedruckt ist. Man wählt das passende Paket und klickt auf „Anmeldung“ und schon kann man surfen und das Bordkonto wird mit dem entsprechenden Betrag belastet.
Dabei ist Doris und mir aufgefallen, dass der PIN-Code nicht eine zufällige Ziffernkombination ist, sondern sich ganz profan aus Tag und Monat des eigenen Geburtstages zusammensetzt. An das Geburtsdatum von einigen Reisenden ranzukommen ist einfach.
Jeden Tag wird in den Restaurants jemand mit Torte und Ständchen gebührend gefeiert. (siehe auch Blogeintrag vom 23.12.2016). Jetzt muss man sich nur noch das Gesicht des Geburtstagskindes merken und wenn dieses in irgendeiner Bar oder Restaurants etwas zu trinken bestellt, wird man die Kabinennummer, die man ja für den Kauf eines Internetpakets noch braucht, erfahren. Denn entweder fragt der Kellner nach der Kabinennummer oder aber er ist einer der hier gar nicht so seltenen Gedächtnisgenies, der die Nummern vieler Passagiere im Kopf hat und diese dann dem Passagier nennt, um sie sich so bestätigen zu lassen.
Unser Gespräch um diese doch recht eklatante Sicherheitslücke bekam ein Phoenix-Mitarbeiter zufällig mit und versuchte unserer Kritik zu entschärfen:
- Es habe einen solchen Vorfall eines unberechtigten Zugriffs noch nie gegeben.
- Der Phoenix-Passagier ist ehrlich.
- Mit denselben Anmeldedaten (Kabinnennummer, Pin) könnten 2 Personen nicht gleichzeitig ins Internet.
- Bei jeder Anmeldung wird die Gerätenummer des Computers oder Smartphones protokolliert und aufgezeichnet.
Am 4. Punkt der Argumente (Protokollierung der Anmeldung) ist zwar ein bischen was dran, bedeutet aber lediglich, ein Hacker sollte Phoenix seine Gerätenummer nicht mitteilen und sich beim "Fremdsurfen" nicht erwischen lassen.
Ich bin zwar kein Hacker, aber ich teile Phoenix trotzdem nicht die Gerätenummer (die sog. MAC-Adresse) meines Netbooks mit. Wozu auch? Denn die würden an der Rezeption bestimmt sehr erstaunt gucken wenn ich Ihnen einen Zettel mit "30:3A:64:12:72:C6" überreichen würde.
Oder man nutzt einfach einen der 6 PCs, die Phoenix den Passagieren im Jamaica-Club zur Verfügung stellt. (Die werden ganz bestimmt noch nicht videoüberwacht.)
Auch wenn bisher in dieser Richtung tatsächlich noch nichts passiert ist, irgendwann wird es passieren, da man sich mit so wenig krimineller Energie einen geldwerten Vorteil verschaffen kann. Und der geprellte Passagier, dessen Daten so missbraucht werden, hat dann halt ein Problem in Form einer Rechnung an der Backe.
009. Reisetag - Donnerstag, 29.12.2016 Seetag
Für heute wurden zwei Open-Air-Veranstaltungen angeboten.
Um 16 Uhr der „MS Artania FernSEEgarten“, angelehnt an die ähnlich klingende ZDF-Sonntagvormittagssendung. Ein bisschen Kochshow, ein wenig Mode, Musik und ein philippinischer Eisschnitzer. Der kühle Wind und mein mäßiges Interesse trieben mich aber schnell wieder in das Schiffsinnere.
Am Abend auf den Achterdecks wurde auf der „White-Lounge-Party mit Tanzhitparade“ jedem Passagier, der in einem weißen Outfit erscheint, ein Freigetränk versprochen. Auch hierüber kann ich nichts berichten, da das Wort „Tanzhitparade“ in meinen Ohren gefährlich klingt, könnte es doch sein, dass das ein Tanzwettbewerb ist, in den man, ehe man sich versieht, von der Reiseleitung reingeschupst wird. Die Chance zu gewinnen wäre sowieso sehr gering, da ich schon am Vormittag den Tango-Tanzkurs geschwänzt hatte.
010. Reisetag - Freitag, 30.12.2016 Seetag
Um 11.30 Uhr ist plötzlich der Sommer ausgebrochen. Strahelnder Sonnenschein, kaum Wind und Temperaturen über 20°.
011. Reisetag - Samstag, 31.12.2016 (Silvester) Seetag
Eigentlich ein Seetag wie die anderen vorhergehenden auch. Und dass im Tagesprogramm für den Abend als Bekleidungsvorschlag wieder feiner Zwirn empfohlen wird, schreckt uns auch nicht mehr. Das Gala-Abendessen war eher (erwartungsgemäß) mittelmäßig, aber dafür war das Lido-Buffet-Restaurant mit Luftballons und Luftschlangen schön geschmückt und so langsam kam dann doch Silvesterstimmung auf.
Nach dem Abendessen strömten die Leute entweder in die Admiral-Lounge zur Silvester-Gala-Show oder es zog sie nach oben auf Deck 9 in die Pazifik-Lounge, wo ein Comedy-Programm angesagt war oder sie blieben erst mal, wie wir, in Harry’s Bar, wo uns ein Tischzauberer im Laufe des Abends allerlei Kurzweil verbreiten sollte.. Im Bordkino lief „Dinner For One“ in einer Endlosschleife und am Heck brachte die bordeigene „Impression Band“ ihre Instrumente und Equipment in Position.
Die Küchencrew baute ein riesiges Buffet auf, die Eisschnitzer hatten bereits aus Eisblöcken die Ziffern 2,0,1,6 und die 7 geformt und irgendwelche Heinzelmännchen hatten mit hunderten von Luftballons die Geländer an den hinteren, offenen Außendecks geschmückt.
Es war wirklich sehr beeindruckend, was aufgeboten wurde um den anstehenden Jahreswechsel gebührend zu feiern.
Gegen 23 Uhr wechselnden Doris und ich von Harry’s bar zu den achtern liegenden Außendecks, wo die Party schon im vollen Gange war. Die Band, deren Reportoire durchaus zumindest teilweise auch am Ballermann Gehör gefunden hätte, lockte doch einige Tänzerinnen und Tänzer auf die Tanzfläche.
Da wir im Laufe der Reise schon fünfmal die Uhr um eine Stunde zurückgestellt hatten, war in Deutschland zu dieser Zeit der Silvesterdrops schon weitestgehend gelutscht.
Ab 23.30 Uhr gesellten sich viele Crewmiltglieder zur Silvesterparty. Normalerweise ist es ihnen nicht gestattet, sich außerdienstlich im „Publikumsbereich“ aufzuhalten, aber heute durften sie. Ich schätze mal, so knapp 100 meist junge Menschen machten von dieser Gelegenheit gebrauch.
Kurz vor Mitternacht wurde Sekt und Kreppel (Berliner Pfannkuchen) verteilt, Der Kapitän hielt eine kurze Ansprache und läutete mit der Schiffglocke, die man von der Brücke hierher nach Achtern gebracht hatte, nach kurzem Count-Down das neue Jahr ein.
Frau Gleis-Wiedemann sang „Auld Lang Syne“*
Quelle: Wikipedia
Ich mag dieses Lied sehr gerne und die Darbietung hätte bestimmt etwas Ergreifenden gehabt. Allerdings ging der Gesang total unter, weil die Menschen erwartungsgemäß damit beschäftigt waren sich gegenseitig ein „Frohes neues Jahr 2017“ zu wünschen. Vielleicht wäre es besser gewesen, erst das kleine Feuerwerk abzubrennen und dann das Lied zu singen.
Das kleine Feuerwerk, so wurde es wörtlich im Tagesprogramm angekündigt, entpuppte sich als ein recht ordentliches Spektakel, das zu den Klängen von Georg Friedrich Händels „Wassermusik“ abgebrannt wurde und den Zuschauern etliche Aaahs und Ooohs entlockte.
Mittlerweile war auch das Buffet eröffnet, wobei der Hummer, der mehr als reichlich vorhanden war, wohl die Hauptattraktion war. Da ich durch das erst vor drei Stunden beendete Abendessen und durch den Genuss der wohlschmeckenden Kreppel sehr satt war und ich eh keinen Hummer mag (Was der Bauer nicht kennt…), begnügte ich mich mit einem Frankfurter Würstchen.
Irgendwann hörte die Band auf zu spielen und der Schiffseigene DJ sorgte nahtlos für den musikalischen Nachschub.
Irgendwie hatte ich an diesem Abend den Eindruck, dass die Passagiere in ihrer Gesamtheit mindestens 10 Jahre jünger waren als an den vergangen Tagen.
Ob dieser Eindruck ein bleibender sein wird, wage ich allerdings zu bezweifeln.
Auf jeden Fall gebührt den Organisatoren und den vielen Leuten, die an der Vorbereitung und der Durchführung dieses Silvesterabends gearbeitet haben ein ganz dickes Lob.
Fazit: Weihnachten auf dem Schiff ist gewöhnungsbedürftig, denn Weihnachten ist eigentlich etwas Privates und Persönliches.
Aber Silvester, so wie es hier auf der Artania stattgefunden hat ist OK und hat Spaß gemacht.
012. Reisetag - Sonntag, 01.01.2017(Neujahr) Seetag
Das neue Jahr fing genauso an wie das alte Jahr aufgehört hat - mit einem Büffet.
Ein Jazzfrühschoppen war angesagt. Ich erspare dem Leser bzw. Betrachter weitere Bilder von der „Fresstheke“, es würde ihn mittlerweile langweilen.
Ein kleiner Unterprogrammpunkt des Frühschoppens war das Überbordwerfen des Wish-Trees.
Der Wish-Tree (Wunschbaum) ist ein Tannenbäumchen, das in Harry’s Bar gestanden hat. Daneben lagen Zettel, Kuli und Bindfaden. Man konnte auf einen Zettel einen Wunsch aufschreiben und den Zettel mittels bereitliegendem Bindfaden am Baum befestigen.
Angeblich soll Neptun dafür sorgen, dass die Wünsche erfüllt werden, wenn man den Baum ins Meer wirft. Nun war es soweit. Zu dieser Zeremonie waren sowohl die Reiseleiter als auch die Musiker, die unentwegt „When the saints go marchin‘ in“ spielten, alle in schwarz gekleidet, als trauere man dem vergangen Jahr nach.. Schließlich landete der Baum im Wasser und die Musiker zogen ab, wobei sie, wer hätte das gedacht, „When the saints go marchin‘ in“ spielten.
Das Ganze erinnert mich sehr an den 1. Wächtersbacher Carnevalverein e.V. 1961, dessen Komitee-Mitglieder am Aschermittwoch alle in schwarze Fräcke gehüllt und Zylinder auf dem Kopf die gerade abgelaufene Fastnachtscampagne zu Grabe tragen.
(Nähere Infos unter www.wcv.info; Webmaster dort ist übrigens Peter Hölzer)
Gegen17.00 Uhr haben wir die erste Möwe entdeckt. Wir näheren uns wieder festem Boden.
013. Reisetag - Montag, 02.01.2017 - Philipsburg / St. Maarten / Niederl. Antillen
Die Atlantiküberquerung ist geschafft und wir machen morgens um acht Uhr an der Pier von Philipsburg fest. Es sind bereits schon drei weitere Kreuzfahrtschiffe da, die MSC Poesia (bis zu 3000 Passagiere), die Celebrity Summit (bis zu 2400 Passagiere) und die Star Legend (Passagierzahl mir nicht bekannt).
Die ursprünglichen Ausflugsangebote hat Phoenix wieder gestrichen, über die Gründe kann man nur spekulieren. Vor zwei Jahren waren wir ja bei unserer Südamerikarundreise schon mal hier und da haben wir die Unzuverlässigkeit unseres Busses gepaart mit chaotischen Verkehrsbedingungen erlebt. (siehe Reiseblog Südamerika 12. Blogeintrag zum 31.3.2015 )
Deshalb gingen wir unseren ersten Tag in der neuen Welt locker an. Mit dem Wassertaxi wollten wir ins nahegelegene touristische Zentrum. Hierzu musste zunächst eine schwierige Entscheidung getroffen werden. Die einfache Fahrt kostet 5 US-Dollar, die Tageskarte für belieb viele Fahrten hin und her kostet 7 Dollar. Wir entschieden und für die Tagesflatrate. Hierzu legte die Kassiererin jedem von uns ein Papierbändchen um das Handgelenk, wie man es auch von All-Inklusive-Ferienanlagen kennt. Das Wassertaxi entpuppte sich als ausgewachsener „Wasserbus“ mit Platz für 150 Passagiere.
Im Zentrum angekommen lehnten wir erst mal das Angebot für den 2 Strandliegen, einen Sonnenschirm und 5 Flaschen Bier für schlappe 25 Dollar ab. Also raus aus dem touristischen Trubel und etwas weiter von der Strand- und Uferpromenade weg. Dort war es aber so uninteressant und auch ein wenig schäbig, dass selbst wir keinerlei touristischen Honig daraus saugen konnten und kehrten reumütig Richtung Meer zurück. Hier fanden wir auch eine Strandbar mit WLAN. Jeder von uns mit einer Dose Cola (a 2 US-Dollar) und dem WLAN-Passwort („layback246“) bewaffnet nahmen wir Platz und waren nach 6 Tagen Internetabstinenz wieder mit dem Welt verbunden. Ich konnte den 2. Blogeintrag online stellen, was aber nicht ganz so einfach war, weil, obwohl im Schatten sitzend, das Display des Netbooks kaum lesbar war und die Suche nach dem Mauszeiger geriet zum Geduldspiel.
Buden, Bars und Restaurants, meist aus Holz und immer bunt und farbenfroh, Musiker mit Steeldrums, Touristenpreise (Hamburger mit Pommes 22 Dollar), so stellte sich dar Ort uns dar. Irgendwann waren wir wieder am Hafen, setzen und auf eine Bank um ein wenig Kreuzfahrtpassagiere zu beobachten.
Um 15.30, rechtzeitig zur Kaffeestunde waren wir wieder auf dem Schiff. Und für das ausgefallene Mittagessen gab es Kuchen und Sandwiches.
Als die Artania um 20.00 Uhr ablegte hatten wir immer noch unser Wassertaxiflatratebändchen um und wussten jetzt, dass das einfache Ticket für 5 Dollar genügt hätte.
014. Reisetag - Dienstag, 03.01.2017 - Virgin Gorda / British Virgin Islands
Diese Karibikinselchen (22 km2) hat gerade mal knapp 400 Einwohner und keine Pier, die groß genug ist, dass wir anlegen können. Also liegen wir auf Reede, d.h. das Schiff hat ca. 1 Seemeile vor Spanish Town, dem Hauptort der Insel den Anker geworfen. Mit den Tenderbooten (das sind die Rettungsboote vom Schiff, die als schwimmende Shuttlebusse eingesetzt werden) kommen wir gegen 10.00 Uhr an Land.
Die Attraktion der Insel ist der Strand „The Bath“, ein Strand, an dem gewaltige Granitblöcke eine zum Meer hin offene Grotte bilden. Allerdings haben wir den Ausflug dorthin nicht gebucht und marschieren auf eigene Faust durch den Ort. Große Sensationen gibt es nicht zu berichten.
Eine Henne mit Küken überquert die Straße, ein blühender Strauch der von bunten Schmetterlingen besucht wird, erregt unsere Aufmerksamkeit und ein Gemüseverkäufer, der einen Tisch mit seiner spärlichen Auslage auf einem Parkplatz aufgestellt hat. Mit Letzterem kommen wir ins Geschäft. Eine Handvoll Tomaten wechseln für 2 US-Dollar den Besitzer. Klar, dass er uns mit dem Preis übers Ohr gehauen hat, aber was soll’s. Zum Trost schenkt er uns noch zusätzlich zwei weitere Tomätchen.
In der Nähe des Anlegers für die Tenderboote in einer Bar trinken wir jeder noch eine Dose Cola (a 2 Dollar), denn dafür verrät und die Dame hinter dem Tresen das WLAN-Passwort („abolute1“). 2 Dollar scheint wohl in der Karibik eine Standardpreiseinheit zu sein.
Pünktlich zum Mittagessen sind wir auf der Artania zurück. Die Tomaten schmeckten übrigens nicht schlecht, allerdings blieb die von mir erwartete Geschmacksexplosion am Gaumen aus.
Um 14.00 Uhr wurde der Anker gelichtet und das morgige Ziel angesteuert.
015. Reisetag - Mittwoch, 04.01.2017 - La Romana / Dominikanische Republik
Heute stand ein ganz spezieller Ausflug auf der Tagesordnung. Der Hafenagent fuhr Doris und mich, sowie zwei weitere Damen mit seinem Minivan zu einer Zahnarztpraxis. Organisiert hatte diese Tour die Ärztin vom Schiffshospital, weil mich seit einigen Tagen entzündetes Zahnfleisch nervte, nicht besonders schlimm, aber es musste doch behandelt werden. Die beiden anderen Damen hatten auch Zahnprobleme und Doris fuhr als seelische Betreuung bei diesen Sammeltransport mit.
Die Fahrt dauerte nur wenige Minuten und die Praxis machte einen guten, sauberen modernen Eindruck. Man bot uns Tee und Kaffee an, es gab freies WLAN und ein riesiges Aquarium im Warte- und Behandlungszimmer soll beruhigend auf die Patienten wirken.s
Bevor wir irgendjemanden über Art und Umfang der dentalen Beschwerden berichten konnten, wurden wir zunächst alle erst mal geröntgt und zwar gründlich. Es wurde eine 180°-Aufnahme gemacht, d.h. das gesamte Gebiss wurde in seiner voller Schönheit von links nach rechts auf Röntgenfilm gebannt. Da hatte Doris aber Glück, das man sie nicht auch gleich mit durchleuchtet hatte.
Schließlich wurde ich von der Zahnärztin gefragt, wo der Schuh drückt. Zahnfleischentzündung um einen künstlichen Zahn, einem Implantat. Kein Problem, da wird das Zahnfleisch ein wenig angehoben und gesäubert. Die Unterhaltung lief auf Englisch, was insofern ein wenig problematisch war, weil das Englisch der Ärztin wegen des spanischen Akzents sehr schwer zu verstehen war und mein Schulenglisch auch nicht das Beste ist. Aber ich war dennoch gut vorbereite, denn ich hatte mir vorher aus dem Wörterbuch extra folgende Vokabeln rausgesucht:
- Zahnfleisch - gum
- Implantat - implant
- lokale Betäubung - local anethesia
Ich nahm auf dem einen Behandlungsstuhl Platz und auf dem zweiten Behandlungsstuhl in diesem Raum eine der beiden Reisekolleginnen. Ich bekam meine „local anesthesia“. Aber dann die wurde mir aber noch Blut abgenommen. Das würde gebraucht, weil man damit ein körpereigenes Plasma herstellen würde, das in oder um das Implantat eingebracht werden soll, weil das gut für die Heilung wäre.
Dann geschah erst mal lange nichts, weil meine Reisekollegin im Nachbarstuhl behandelt wurde. Als sie fertig war, musste ich meinen Stuhl verlassen und auf dem Ihren Platz nehmen. Als man mir dann auch noch einen fabrikneuen grünen Umhang brachte, so wie ihn in der Schwarzwaldklinik die Chirurgen tragen und diesen anziehen sollte, schwante mir nichts Gutes. Mit Skalpell wurde der Kiefer und Impantat freigelegt, mit einem Kratzhaken lange und ausgiebig und vor allem mit viel Kraftaufwand gekratzt und geschabt. Ein Hoch auf die „local anethesia“, man spürte wirklich überhaupt nichts.
Nach einer gefühlten Ewigkeit zeigte mir die Zahnärztin stolz ein Röhrchen mit einer hellbraunen Masse. Es war das Plasma, was man aus meinem Blut mittlerweile erzeugt hatte und mit einem ordentlichen Schuss Penicillin veredelt worden war. Das Gebräu wurde nun irgendwie in das Loch, das man mir irgendwo im Mund gegraben hatte, eingebracht. Das Ganze wurde schließlich mit viel schwarzem Bindfaden wieder zugenäht und verknotet. Die dafür notwendigen handwerklichen Fähigkeiten der Ärztin konnte ich dadurch ganz gut würdigen und erkennen, weil sich so ganz langsam meine geliebte Anethesia aus dem Staub machte. Mein verhaltenes Wehklagen über den Verlust meiner Freundin ließ die Zahnärztin relativ kalt und irgendwann war die schier endlose Nadelarbeit auch zu Ende und wirklich schlimm war die Sache nun tatsächlich nicht gewesen.
Man führte mich nun in eine Art Wohnzimmer, platzierte mich in einen bequemen Sessel, nicht ohne mir vorher noch ein Nackenhörnchen anzulegen, schaltet den Fernseher an und maß mir den Blutdruck, der erwartungsgemäß weit über normal lag (ich bin nämlich nicht unbedingt ein Held).
Als Belohnung für meine Tapferkeit strich mit die Zahnärztin liebevoll über den Kopf und sprach tröstende Worte und als Zugabe spendierte sie mir gegen aufkommendes postoperatives Aua noch eine Spritze in den Allerwertesten.
Der Service in dieser Praxis war wirklich erste Klasse und die Rechnung auch: 1.500 US-Dollar, zu entrichten in bar oder per Kreditkarte und vor allem sofort.
Da fielen hinterher die 51 Dollar in der Apotheke für ein Antibiotikum, 6 Schmerz- und entzündungshemmende Tabletten und ein Spray kaum noch ins Gewicht.
1.500 Dollar sei wirklich ein unverschämter Preis meinte später auch die Schiffärztin. Sogar in Singapur würde so eine Behandlung höchstens 1000 Dollar kosten und sie war bisher der Meinung, dass es dort am teuersten auf der Welt sei.
Aber man bedenke, es wurde ja auch wirklich viel teurer Faden vernäht.
Der rein touristische Teil an diesem Tag fiel bei uns übrigens komplett aus.
016. Reisetag - Donnerstag, 05.01.2017 - Halbinsel Samaná / Dominikanische Republik
Da ich mir gestern gleich nach der Behandlung noch eine ordentliche Dosis Ibuprofen genehmigt hatte (4 x 400 mg) und die Backe eine Zeitlang mit den eiskalten Getränkedosen, die ich mit aus der kabineneigenen Minibar ausgeliehen hatte, gut gekühlt hatte, war ich heute absolut schmerzfrei.
Ich sollte mich trotzdem schonen und die Sonne meiden. Schonen kann ich gut, aber Sonne meiden in der Karibik ist ganz schön schwierig.
Wir lagen heute ziemlich weit draußen auf Reede und eine einzelne Tenderfahrt dauerte recht lange, nämlich 20 Minuten.
Rund um den Anleger des Tenders war viel touristischer Rummel. Einen kleinen Ausflug mit einer Moped- Rikscha hätte man z.B. machen können, aber so richtig Lust hatte wir nicht, da uns trotz wortgewaltiger Erklärung des Fahrers Ziele und Umfang der Fahrt ganz klar wurden.
Also machten wir nur einen kleinen Spaziergang entlang der Uferpromenade. Wir besichtigten eine alte Kirche. Im Reiseführer ist über sie vermerkt, dass man sie Ende des 19. Jahrhunderts in England abrissen hat, die Steine hierher verschiffte und das Ganze dann hier wieder aufbaute.
Viel mehr gibt es heute auch nicht zu berichten. Vielleicht noch, dass gestern das Filmteam für „Verrückt nach Meer“ an Bord gekommen ist, zusammen mit „Reiseleiter Bernd“ (Phoenix-Mitarbeiter Bernd Wallisch), der schon in vielen Verrückt-Nach-Meer-Episoden ins Bild gesetzt worden war und den Hardcore-Fans dieser Sendung sicher ein Begriff ist (neben Kapitän Hansen, Dr. Winnie Koller und Kreuzfahrtdirektor Thomas Gleis).
Bei der Grillparty am heutigen Abend, die unter dem Titel „Karibisches BBQ“ lief wurde schon fleißig gefilmt.
Das Grillgut war von ausgezeichneter Qualität. Der Rindfleischspieß zum Beispiel brauchte den Vergleich mit einem Steak bei Maredo nicht zu fürchten. Heute Abend war alles stimmig, von der Deko, der Musik bis zur Eistheke. Großes Lob an die Küchen- und Restaurantcrew.

Zu den flambierten Bananen paste sehr gut das Chilli-Schololadeneis.
Die beleuchteten Säulen waren übrigens ganz aus Eis
017. Reisetag - Freitag, 06.01.2017 - Grand Turk / Turcs & Caicos
Grand Turk ist die größte Insel der Turks-Inseln, welche gemeinsam mit den etwa 30 km nordwestlich gelegenen Caicos-Inseln das britische Überseegebiet der Turks- und Caicosinseln bilden.
Schon früh um 7.00 Uhr machten wir an der Pier fest. Als wir um 8.30 Uhr auf dem Promenadendeck auf dem Weg zum Frühstück waren, tauchte neben uns plötzlich wie von Geisterhand der riesige Bug der Carnival Sunshine auf, ein Kreuzfahrer für 3000 Passagiere und machte neben und an der Pier fest.
Wie meistens kamen wir vor 10.00 Uhr nicht von Bord, denn in der Ruhe liegt die Kraft.
Das Gebiet um die Pier war rein touristischer Natur. Restaurants, Boutiquen, Souvenierläden, Buden, an denen man Schnorchel- und Bootstouren buchen konnte.
Daran schloss sich gleich ein großer Sandstrand an, auf den wir gleich zusteuerten. Schuhe aus, Hosenbeine hochgekrempelt und ab durch das seichte, warme türkisfarbene Wasser.
Auf dem Rückweg nahmen wir einen Drink an einer Strandbude, wo es selbstverständlich freies WLAN gab. Deutschland ist dagegen in Bezug auf öffentlichen freien Internetzugang ein rückständiges Entwicklungsland.
Aber solch trübe Gedanken verfliegen hier schnell, weil man hier auch ohne weißen Rum das Bacardi-Feeling einstellt - Karibik wie aus dem Bilderbuch.
Um 11.00 Uhr konnten wir von unserer Strandbar aus beobachten, wie unsere Artania ablegte. Wir hatten natürlich nicht vor lauter Glückseligkeit unser Schiff verpasst, sondern die Artania musste Platz machen für einen weiteren US-Riesen, die „Regal Princess“, die im Anmarsch war. Die Artania warf ein wenig außerhalb den Anker und gegen 1.00 Uhr fuhren wir mit dem Tenderboot zurück zu unserem Schiff.
Gestern bat die Kreuzfahrtdirektion per Lautsprecherdurchsage darum, dass die ins Tenderboot Einsteigenden doch bitte nach hinten durchrutschen sollen, damit die folgenden Passagiere nicht über vorne Sitzenden steigen müssen.
Aber ob man einem Ochs ins Horn petzt oder der berühmte Sack Reis in China …
Es täte mir ja ganz ganz furchtbar leid, wenn ich beim nächstenmal, natürlich vollkommen unabsichtlich, so einem Vornesitzer auf die Füße treten würde.
Um 14.00 Uhr legte die Artania ab, mit Ziel Havanna.
018. Reisetag - Samstag, 07.01.2017 - Seetag
Am Vormittag saß ich wieder mal am „beinahe schönstem Arbeitsplatz der Welt“ ,im Jamaica Club, und bereite schon mal so weit als möglich das Hochladen des 3. Blogeintrags vor. Ich hoffe das wird morgen in Havanna klappen.
Ich habe mich über die bisherigen ermunternden Gästebucheinträge gefreut und auch einige persönliche Mails erhalten, in denen sich die Absender positiv über den Blog äußern. Außerdem haben sich mittlerweile über 50 Abonnenten für den Blog-Newsletter angemeldet, die dann automatisch benachrichtigt werden, wenn ein neuer Blogeintrag wieder online geht. Da macht die Arbeit am Blog natürlich doppelt Spaß.
Der Höhepunkt des Tages war sicherlich der Frühschoppen, der mit Freibier, Leberkäse, Weißwurst,Laugenbrezeln und Stimmungsmusik immer wieder die Massen anzieht. Der Frohsinn dauert genau 60 Minuten, nämlich von 11.00 Uhr - 12.00 Uhr, dann stoppt augenblicklich der Freibiernachschub und die Leckereien werden unbarmherzig weggetragen. Es ist schwer, die Zeit bis zum Mittagessen um 12.30 Uhr zur überbrücken. Aber es wird ja auf jeder Reiseetappe eine Wiederauflage geben und es liegen noch 6 weitere Etappen vor uns.
019. Reisetag - Sonntag, 08.01.2017 - Havanna/Kuba Seetag
Bereits gestern Abend gab es eine kurze Durchsage, dass auf Grund der Wetterlage der Hafen von Havanna gesperrt sein könnte. In der Nacht fing das Schiff dann auch tatsächlich an zu schaukeln und am Morgen schwankte es zwar ganz ordentlich, aber nicht so stark, dass es sich lohnen würde, darüber extra zu bereichten. Um 10.00 Uhr sollten wir planmäßig einlaufen, aber bis 9.30 Uhr gab es keinerlei Infos oder Durchsagen, ein schlechtes Zeichen. Dann war es offiziell, der Hafen ist gesperrt und wir würden bis auf unbestimmte Zeit Warteschleifen in gebührendem Abstand vor Havanna drehen.

Das Filmteam von "Verückt nach Meer" war sofort in Aktion und interviewte Reiseleiter Bernd zur derzeitigen Lage
Am Nachmittag gab es die nächste Information. Der Hafen wird frühestens am nächsten Morgen um 7.00 Uhr geöffnet.
Da wir 3 Tage in Havanna liegen würden, trifft uns der „verlorene“ Tag nicht ganz so hart. Schlechter sind da die Passagiere dran, die morgen das Schiff verlassen wollen, um nach Hause zu fliegen.
Eine Stunde später wurde die Information dahingehend präzisiert, dass wir ja nicht nur die Hafeneinfahrt benötigen, sondern auch eine passende Pier brauchen, um anlegen zu können. Deshalb müssen wir morgen auf die Abfahrt der MSC OPERA warten, die die Einfahrt noch geschafft hat und ihren Liegenplatz erst morgen um 14.00 Uhr verlassen wird. Vor 15.00 Uhr ist an ein Anlegen gar nicht zu denken.
Jetzt kommt Phoenix richtig ins Rotieren, nicht nur auf dem Schiff, sondern auch in der Zentrale in Bonn. Die Vormittagsflieger nach Europa werden nicht mehr erreicht und es müssen etliche Passagiere irgendwie umgebucht werden. Das gesamte Ausflugsprogramm ist hinfällig bzw. wird teilweise neu terminiert.
Da wir weder nach Hause fliegen noch Ausflüge gebucht haben, sind wir immer noch relativ gelassen. Die Reiseleitung öffnet den Weinkeller und spendiert vor dem Abendessen ein Gläschen Grauburgunder Spätlese, um die Gemüter etwas zu beruhigen.
Erst als wir am Abend mit dem Tagesprogramm für den folgenden Tag auch noch die Information erhalten, dass die Abfahrt aus Havanna am dritten Tag nicht um 20.00 Uhr, sondern bereits um 12.00 Uhr erfolgen soll, entfährt uns das böse Wort, das mit „Sch…“ anfängt.
020. Reisetag - Montag, 09.01.2017 - Havanna/Kuba
Zum Frühstück gab es heute Sekt - warum wohl? Die Meldung, dass der Hafen immer noch geschlossen ist, und eine Einfahrt heute früh sowieso nicht möglich gewesen wäre. hebt die Stimmung auch nicht unbedingt.
Nach dem Frühstück ging ich wieder in mein „Büro“, dem Jamaica-Club und notiere die aktuellen Entwicklungen in mein Netbook.
Der Kapitän, Jens Thorn, ein typischer, alter Seebär, kommt zufällig vorbei und erzählt, dass ihm die kubanischen Behörden „bis hier“ stünden. Emails werden nicht beantwortet und das Telefon wird nicht abgehoben. Er weiß, dass die Windstärke im Hafen höchsten 4 beträgt und eine Einfahrt absolut unproblematisch sei, aber wenn die Behörden nicht wollen, dann wollen sie nicht.
Drei Mitarbeiter von Phoenix kommen vorbei und erklären, sie seien ein „Einarmiger Bandit“. Man drückt gegen den Arm des männlichen Teils des Spielautomaten und jeder der drei humanoiden Komponenten zieht unter Absonderung spielautomattypischer Geräusche eine Frucht aus dem Hut. Bei drei gleichen Früchten gewinnt man einen Cocktail.
Phoenix zieht wirklich alle Register.
Am Nachmittag gegen 16:00 Uhr machen wir endlich an der Pier fest. Es gibt zwar vielleicht 10 Piers jeweils mit Hafengebäude, aber lediglich bei unserem Anleger ist das Gebäude noch halbwegs intakt, bei den anderen handelt es sich eher um Ruinen. An der Pass-Stempelstelle hatte es sich noch einmal ein wenig geknäuelt, aber um 17.30 Uhr standen wir tatsächlich mit beiden Füßen auf festem Boden in Havanna. Wir lagen mit der Artania direkt in der Altstadt, sodass wir bequem zu Fuß alle Wichtigen Sehenswürdigkeiten erreichen konnten.
Paläste, Museen, Kirchen, Wohngebäude im Kolonialstil und viele großzügig angelegte Plätze und die gepflasterten Straßen und Gassen geben der Altstadt ein ganz besonderes Flair, schwer zu beschreiben. Vielleicht ein wenig vergleichbar mit dem French Quarter in New Orleans.
Natürlich stechen an Uferstraße die Oldtimer ins Auge, die als Taxen und Ausflugsfahrzeuge eingesetzt werden. Da gibt es alte klapprige Rostlauben und tiptop im Schuss gehaltene chromblitzende Schätzchen, sowohl als Cabrios als auch geschlossene Limousinen. Aber auch Motorad- und Fahrradrikschas stehen zur Verfügung.
Es wurde dann sehr schnell dunkel und man orientierte sich natürlich an den besser beleuchteten Gassen und mied die dunklen Straßen. In und um die vielen Restaurants wurde fleißig musiziert und wir ließen uns ziellos treiben, denn es gab immer irgendwo etwas zu sehen oder zu bestaunen. So seien hier nur zwei Beispiele genannt; der Bierausschank, in dem man das Bier in einem 3-Liter-Glaszylinder zum Selbstzapfen serviert bekommt und das Restaurant, das einem Kloster nachempfunden ist und die Kellner in Mönchskutten gehüllt sind.
021. Reisetag - Dienstag, 10.01.2017 - Havanna/Kuba
Entgegen unseren sonstigen Gepflogenheiten traten wir unseren Landgang nicht erst um 10.00 Uhr sondern bereits um 9.00 Uhr an, denn um 11.00 hieß es schon wieder - „alle Mann an Bord!“. Zwar war für die Abfahrt nach wie vor 12.00 Uhr vorgesehen und normalerweise ist eine halbe Stunde vor Abfahrt der letzte Einschiffungstermin, aber für 11.15 Uhr war die Rettungsübung angesetzt, die seltsamerweise auch wir dieses Mal wieder absolvieren mussten, obwohl wir ja schon eine in Genua absolviert hatten. Man hat uns von der knappen Zeit also noch mal eine halbe Stunde weggenommen.
Wir wandelten zunächst noch einmal auf unseren gestrigen Spuren, dieses Mal im Hellen. Uns fallen Schlangen vor Banken, Wechselstuben und Geldtransfer-Dienstleister (z.B. Western Union) auf, die alle erst um 10.00 Uhr öffnen. Die Auslagen und Angebote in den wenigen Lebensmittelgeschäften, wie Bäckereien oder Fleischereien in und um den touristischen Kern der Altstadt sind eher dürftig.
Für den Rückweg zum Schiff entschieden wir uns für einen Weg durch ein Sträßchen einen Block weiter parallel zur Touristenmeile. Da sah die Welt schon anders aus. Viele von der Substanz her schöne alte Gebäude sind dem Verfall preisgegeben.
Im Hafengebäude wurde erneut von den kubanischen Behördenunser Pass und das Gepäck gecheckt, was aber dieses Mal relativ zügig abging und trafen pünktlich am Schiff ein.
Um 12.00 hieß es wieder mal „Leinen los“ und unser nächstes Ziel hieß: Cozumel in Mexico:
022. Reisetag - Mittwoch, 11.01.2017 - Cozumel/Mexico
So Ärgerlich die Umstände um den verkürzten Aufenthalt in Havanna auch waren, die Phoenix-Reiseleitung auf der Artania und die Phoenix-Mitarbeiter am Sitz der Firma in Bonn habbeziehen. Außerordentliches geleistet.
Praktisch gleichzeitig gingen 500 Passagiere von Bord während 600 neue einschiffen wollten und ihre Kabinen beziehen.
Normalerweise wird das Gros der Abreisenden vormittags mit Bussen zum Flughafen gebracht und am Nachmittag gegen 16.00 Uhr checken die Neuen ein. Das geschah jetzt alles gleichzeitig - rein und raus.
Vorher mussten Flüge umgebucht werden, das Ausflugsprogramm war ja in sich zusammengefallen und wurde neu organisiert
Ich wurde vom Filmteam „Verrückt nach Meer“ zum Thema „verkorkstes Havanna“ interviewt und gefilmt. Aber da aber ca. 80% des gedrehten Materials dem Filmschnitt zum Opfer fällt, wird meine Fernsehkariere wohl noch etwas warten müssen.
Als kleines Trostpflaster legten wir heute außerplanmäßig Cozumel/Mexico an, anstatt einen Tag auf See zu verbringen. Dies war dadurch möglich, dass wir ja gestern 8 Stunden früher als geplant Havanna verlassen mussten.
Die Kreuzfahrer „Mein Schiff 4“ und die „Norwegian Pearl“ waren schon da, beides Schiffe für jeweils 2500 bzw. 3000 Passagiere.
Aber die Gegend um die Pier war darauf vorbereitet, Duzende Schmuck- und Uhrengeschäfte, unzählige Andenkenläden, Cafés und Kneipen, laute Techno-Musik.
Wer Kultur wollte, musste Ausflüge machen, z.B. nach Chichén Itzá zu den Ruinen und einer gut erhalten Pyramide der Maya.
Da wir diese Kulturstätten vor einigen Jahren schon besucht hatten, blieben wir hier am mexikanischen Ballermann, suchten uns etwas Abseits in einer Seitenstraße eine Kneipe (natürlich mit WLAN) und gingen den Tag locker an.
Am Nachmittag gingen wir in ein nahegelegen Kaufhaus ein wenig shoppen. Wir hatten gesehen, dass von dort unzählige Crew-Mitglieder bepackt mit Plastiktüten herkamen, ein Indiz dafür, dass dort kein Touristennepp stattfindet. Und so war es. Wir erstanden noch etwas Hausrat für unsere Kabine, z.B. weitere Kleiderbügel, Plastikschüsselchen zu Aufbewahrung von Krimskrams, der sonst lose auf dem Schreibtisch rumfliegt und sonst noch dies und das.
Wir verließen den Hafen von Cozumel erst um 23.00 Uhr, denn unser nächstes Ziel, Costa Maya, ist nur 135 Seemeilen entfernt. Bei einer Geschwindigkeit von 15 Knoten, schaffen wir das in 135:15 = 9 Stunden.
023. Reisetag - Donnerstag, 12.01.2017 - Costa Maya/Mexico
Costa Maya, gelegen auf der Halbinsel Yucatán ist kein Ort, sondern nur eine Anlegestelle für Kreuzfahrtschiffe mit einem reinen touristischen Areal - eine künstliche "Plasrikwelt". Wohnen tut hier niemand.
Neben der Artania liegt die Norwegian Getaway, ein in der Meyer Werft gebautes Schiff (Kosten 600 Mio. €) für 4000 Passagiere. Aber keine Sorge, die Commercial Area rund um die Pier war groß genug für die Passagiere beider Schiffe. Der unvermeidliche Schmuck- und Diamantenladen, unzählige Andenkenläden, Restaurants, Bars, Poollandschaften, ein kleiner künstlicher Stand mit einer kleinen künstlichen Lagune, Live Musik. Man konnte sich massieren lassen oder für 35 $ Delfine streicheln, die in viel zu kleinen Becken gehalten wurden.
Jedenfalls wurde das wohl alles so für den amerikanischen Kreuzfahrtmarkt eingerichtet und designt.
Im Großen und Ganzen war das Areal sehr hübsch und geschmackvoll angelegt.
Von einem kleinen Aussichtsturm sahen wir, dass sich etwas weiter außerhalb der „Commercial Area" ein Gebäude mit der Aufschrift „Museo Maya“ befand. Dieses steuerten wir an, vorbei an den unzähligen Taxifahrern und offenen Transportbussen, die uns ihre Dienste feilboten. Das Museum jedoch war gar nicht in Betrieb. Also ging es weiter vorbei an einer Replik einer Mayapyramide zu einem Spaßbad mit angeschlossenem Erlebnis- und Abenteuerpark, welches ebenfalls dem Baustil der Mayas nachempfunden war- Eintritt 75 US-$. Selbst wenn wir hätten baden wollen und auf den großen Wasserrutschen hätten rutschen wollen, wir hätten es sich noch einmal gründlich überlegt.

Nervenkitze! Aus einer Höhe von vielleicht 30 Meter drehten sich 4 Männer wie bei einem Kettenkarussell, nur durch ein Seil um Bauch und Bein gesichert. Mit jeder Umdrehung wurde auf einer Rolle an der Spitze der Stange etwas Seil freigegeben, sodass sich die Männer langsam dem Erdboden näherten.
Da es sonst überhaupt nichts gab, was man sich noch hätte anschauen wollen, gingen wir zurück ins „Vergnügungsviertel", denn zu einer Fahrt in den nächstgelegenen „richtigen Ort“ hatten wir keine Lust und machten lieber einen auf faulen Touristen, teils auf dem Schiff, teils im „Vergnügungsviertel“.
Um 20.00 Uhr hieß es wieder „Leinen los“ mit Ziel Belize.
024. Reisetag - Freitag, 13.01.2017 - Belize City/Belize
Belize hieß bis 1981 Britisch Honduras und liegt, wie unser gestriges Ziel in Mexico, auf der Halbinsel Yukatan.
Obwohl in der Nacht die Uhren um eine Stunde zurückgestellt wurden (zum siebenten Mal auf dieser Reise), war das Aufstehen um 5.30 Uhr eine echte Herausforderung. Aber bereits um 7.20 Uhr sollte ja unser Ausflug „Bootsfahrt auf dem Old River“ stattfinden.
Wir ankerten 2 - 3 Seemeilen vor Belize City und wurden, tenderten aber nicht mit den schiffseigenen Booten, sondern wurden von einheimischen Katamaranen an Land gebracht.
Dort stiegen wir und noch ca. 149 weitere Passagiere in die drei bereitstehenden Ausflugsboote um. Nach einigen Seemeilen in Küstennähe bogen wir in die Mündung des Beize River, auch Old River genannt, ein. Die Ufer waren zunächst von Mangroven gesäumt aber nach einiger Zeit war man mitten im tropischen Regenwald. Der Führer, ein echtes Original, lachte gerne und hatte anscheinend Spaß daran uns Touris die Tier- und Pflanzenwelt zu erklären. Seine Ausführungen erfolgten zwar in Englisch, aber er sprach langsam, deutlich und laut genug, die Außenborder zu übertönen, sodass er gut zu verstehen war.
Wir sahen zwei Leguane, ein Krokodil, einige Brüllaffen (allerdings sehr weit und sehr hoch auf den Bäumen), mehrere Vogelarten, darunter den selten zu beobachteten Turkan, eine kleine Kolonie Fledermäuse und sogar einige Delfine hatten sich in den Fluss verirrt.
Vor allem aber hat uns die Fahrt selbst durch den grünen Dschungel gefallen.
Nachdem wir gut 3 Stunden unterwegs gewesen waren, gab es eine kurze Pippi-Pause an einem am Ufer gelegenen Ressort und zurück ging es dann im Expresstempo. Als wir wieder die Flussmündung erreicht hatte wurde noch der dritte Außenborder angeworfen und so nochmal einen Zahn zugelegt.
Rund um die Bootsanleger befand man sich im normalen Trubel mit Andenkenläden und Restaurants.

Die Schmuckladenkette "Diamonds International" findet man an jeder Pier in der Karibik, wo amerikanische Kreuzfahrtschiffe anlegen
Auch wir kurbelten die Wirtschaft von Belize an, indem wir einen Kühlschrankmagneten, zwei Aufnäher mit dem Wappen von Belize und ein Brillenetui für Doris‘ Sonnenbrillen erstanden. Interessant war dabei der Bezahl- und Buchungsvorgang. Laut Preisschilder hätten wir 19 US-Dollar zahlen müssen, aber das Mädel an der Kasse stellte uns nur 18 $ in Rechnung. In die Registrierkassse (die keine Anzeige für den Kunden hatte) tippte sie aber nur 15 Dollar ein, was ich zufällig beobachtet hatte - oder hatte ich mich getäuscht? Nein, denn aus unerfindlichen Gründen wurden die Endsummen der einzelnen Käufe noch einmal auf einer Papiertüte, die wohl als Tagesjournal diente, dokumentiert. Und auch da wurden sorgfältig 15 $ notiert.
Wer da jetzt beschissen wurde, die Steuer oder der Eigentümer des Ladens, konnte ich trotz meiner investigativen Beobachtungen nicht feststellen.
Um 18.00 Uhr lichteten wir den Anker und der Feierabend eines schönen erlebnisreichen Tags wurde eingeläutet und später in Harrys Bar beendet.
025. Reisetag - Samstag, 15.01.2017 - Santo Tomas de Castilla/Guatemala
Um 7.00 Uhr Morgens erreichten wir unseren Liegeplatz. Es hatte die Nacht über geregnet, sodass die man sah, wie die umliegenden dichten Wälder so richtig dampften - ein großartiger Anblick.
Heute stand ein gebuchter Ausflug ganz im Zeichen der Mayakultur, eine Busfahrt zur Kultstätte Quiriguá.
Ein großer Bus und nur knapp 20 Leute machte die Fahrt recht angenehm. Wir hatten die Variante mit einem englischsprachigen Guide gewählt. Nicht weil wir besonders gut Englisch können, sondern weil die deutschsprachigen Führer oft ein so schlechtes Deutsch sprechen, dass man es kaum verstehen kann. Also verstehen wir lieber ein gutes Englisch kaum, aber dafür ist die Gruppe klein und das Wichtigste hatten wir schon vorher sowieso schon im Reiseführer gelesen.
Unser Guide quasselte pausenlos über Bevölkerung, Schulwesen, Geschichte Guatemalas und bombardierte uns mit Zahlen, sodass irgendwann dann doch die Konzentration nachließ und man einfach aus dem Busfenster schaute.
So bekam man während der 1½ stündigen Fahrt einen guten Eindruck von der Regenwaldlandschaft und der „Wohnsituation“ der Bevölkerung. Zwar gab es hin und wieder kleinere Dörfer und Orte, aber meistens standen nur drei bis vier einfache eingeschossige Häuser und Hütten zusammen, oft ohne Stromanschluss , und dann folgten wieder viele Kilometer nur Wald.
Dann wiederum gab es Abschnitte mit Haziendas und großen Weiden, wo entweder Rinder - oder Pferde gehalten wurden.
Quiriguá ist eine mittelgroße Stätte am Unterlauf des Río Motagua. Das zeremonielle Zentrum befindet sich etwa 1 km vom linken Flussufer. Außergewöhnlich an Quiriguá ist die Tatsache, dass nahezu alle Skulpturen hervorragend erhalten und durch Inschriften datiert sind. Der Zeitraum der Bewohnung fällt in die Klassische Periode der Maya-Kultur. Die Besiedlung begann um 200, der Bau der Akropolis um 550, die Blütezeit mit den Prachtbauten begann ab 700.
Bedeutender als die Architektur sind die vielen Skulpturen Quiriguás, welche zu den eindrucksvollsten des alten Mesoamerika zählen. Dazu gehören ungewöhnlich hohe Stelen (siehe bspw. Bild oben), die aufwendig aus monolithischen Steinblöcken geschnitten wurden. Die größte ist mehr als 10 Meter hoch und wiegt etwa 60 Tonnen. Neben den hohen vertikalen Stelen befinden sich dort eine Anzahl Felsblöcke, die aufwendig in die Form mythologischer Tiere gebracht wurden. Diese Skulpturen werden als Zoomorphen bezeichnet; in ihrer Größe sind sie nahezu einzigartig.
Quelle: Wikipedia
Mehr ist eigentlich zu diesem Ausflug nicht zu sagen - ein Hoch auf Wikipedia!
In einer Halle im Hafengebäude waren jede Menge Souvenirstände aufgebaut, aber spätesten ab dem 5. Stand wiederholte sich das Angebot.
Doris brauchte eine Hülle für ihren Fotoapparat, denn bei ihrer war der Klettverschluss kaputt. Es handelte sich hierbei um ein hübsches Stopptäschchen, dass wir vor vier Jahren in Japan gekauft hatten, Und siehe da, hier in Guatemala gab es das absolut identische Modell in allen nur erdenklichen Farben.
Nachdem der Kauf erfolgreich abgeschlossen war, machten wir noch ein paar Fotos von einer Musik- und Tanzdarbietung, die ebenfalls in besagter Halle stattfand. Somit war neben Kultur auch Kommerz und Folklore auf der Habenseite.
026. Reisetag - Sonntag, 16.01.2017 - Roatán/Honduras
Im Schweinsgalopp durch Mittelamerika - Mexiko, Belize, gestern Guatemala und heute Honduras, allerdings nur für einen halben Tag. Da bot sich ein kleiner Ausflug zu einem der Strände auf der Insel Roatán.
Rund um die Pier gab zig Anbieter von Touren und jede Menge Taxifahrer. Auf dem Schiff erhielten wir die Information, dass ein Transfer zum ca. 7 Kilometer entfernten Strand zwischen 15 und 25 Dollar pro Person kosten würde.
Unser erster Versuch ein Transportvehikel zu bekommen schlug deswegen fehl weil die Gesamtkosten 50 Dollar, nach zäher Verhandlung 47 Dollar betragen.
Schließlich fanden wir jemanden, der uns für 30 $ zum Strand hin und vom Strand zurück fahren würde, zahlbar am Ende der Tour. Top - wir schlugen ein, der Deal ist gemacht. Allerdings hatten wir nicht mit dem Fahrer verhandelt, sondern mit einer Art Vermittler bzw. Vertriebsbeauftragten bzw. Schlepper, der und zum Taxi brachte. Das Taxi entpuppte sich als Mini-Van, in dem schon 6 Leute saßen.

Es mussten mehrere Hürden genommen werden, bevor wir "unseren" kleinen Strand im Beschlag nehmen konnten
Jetzt waren wir zu Acht und 2 Personen hätten noch reingepasst und die versuchte der „Schlepper“ noch zu akquirieren, sodass die Fahrt noch nicht losgehen konnte. Allerdings war die Werbetour des „Schleppers“ nicht vom Erfolg gekürt, sodass er schweren Herzens dem Fahrer das Startsignal gab. Dummerweise wollte der Fahrer jetzt das Fahrgeld einkassieren. Großes Palaver hin und her, der Schlepper wurde wieder beigeholt und die Sache geklärt - Ergebnis: noch nicht zahlen. Stand der Dinge: 2 Passagiere hatten schon bezahlt und die 6 anderen noch nicht.
Aber dann ging es doch tatsächlich los. Der Fahrer fragte, on jemand spanisch spräche und sie da eine Frau beherrschte die Sprache perfekt.
Wir fuhren und fuhren und fuhren, es gab viel zu sehen, aber dass sich 7 Kilometer so ziehen können?
Schließlich stoppte der Fahrer an einem Hotel und erklärte, dass man für 10 Dollar den hoteleigenen Strand einschließlich Liegen, Sonnenschirm und WC benutzen könne.
Hui da war aber was los in unserem Mini-Bus. Die Leipziger Montagsdemonstrationen waren nichts gegen den Aufschrei der jetzt erfolgte. Zum Glück hatten wir die spanisch sprechende Frau an Bord, die schließlich alles klären konnte. Unser „Schlepper“ hatte den Fahrer genau hierher geschickt und der Fahrer dachte, wir wüssten das. Er entschuldigte sich für das Missverständnis und fuhr uns schließlich zu einem kleinen Strand, der zwar auch nicht öffentlich war, sondern zu einer schönen Strandbar gehörte und ebenfalls Eintritt kosten würde, aber wir ihn ausnahmsweise gratis nutzen könnten
So jetzt habe ich eine DinA4-Seite Text gebraucht, um diese Fahrt zu beschreiben.
Unter deutschen Verhältnissen wäre der Bericht kürzer ausgefallen, nämlich etwa so:
"Wir kauften 2 Bustickets für einen Shuttleservice zum Strand. Nach 10 minütiger Fahrt waren wir da."
Wie langweilig!
Der kleine Sandstrand war sicher kein Traumstrand, aber ich war dennoch hoch zufrieden. Stühle Sonnenschirme, Getränke zu bezahlbaren Preisen WLAN und keine Menschenmassen. Man schwamm und plantschte ein wenig und Doris ließ sich von einer mobilen Masseurin die Füße massieren und von einer weiteren Servicekraft 2 Zöpfchen ins Haar flechten.
Der Fahrer holte uns pünktlich wieder ab und brachte uns zurück zum Schiff, das um 14.00 Uhr den Hafen von Roatán verließ.
027. Reisetag - Montag, 16.01.2017 - Seetag
Der heutige Vormittag war vergleichbar mit dem Vormittag des 3. Reisetages (Freitag, 22.12.1016), ebenfalls ein Seetag, denn es fand wieder ein Maritimer Frühschoppen statt, wieder mit Shrimps satt, diversen Fischen, Matjes und Heringssalat. Ich war zwar selbst nicht anwesend, aber ich gehe mal davon aus, dass dieses Mal nicht Frau Gleiss im Nikolauskostüm gesungen hat. Dass gesungen wurde, davon kann man ausgehen, aber wer gesungen hat und was gesungen wurde kann an dieser Stelle leider nicht dokumentiert werden - ein beinahe unverzeihlicher Mangel.
Als Entschuldigung kann ich anführen, dass ich im Schiffshospital Frau Dr. Martina Maurer aufgesucht hatte. Denn entgegen der Prophezeiung der Zahnärztin in der DomRep, dass die Fäden von selbst herausfallen würden, hat sich die filigrane Nadelarbeit in meinem Mund nicht an diese Weissagung gehalten.
Mit der Nummer, bei stark schwankendem Schiff einem nervösen Patienten schmerz- und unfallfrei die Fäden zu ziehen, könnte Frau Doktor, wenn schon nicht im Zirkus, doch zumindest bei der nächsten Crewshow auftreten.
Wer am Abend gesungen hat, das weiß ich wieder. Es war wieder Gala angesagt, die sogenannte Mittelgala, neben der Begrüßungs- und Abschiedsgala, eine der 3 Galas pro Reiseetappe. Das heißt es gibt insgesamt 21(in Worten: einundzwanzig!) Galas auf der gesamten Reise, da diese ja aus 7 Etappen besteht. Ich merke gerade, ich schweife ab.
Also im Rahmen des Galaabends gab es in der Atlantic Lounge eine Show mit der Boygroup „Feuerherz“. Diese 4 jungen Männer fielen natürlich gleich auf, als sie in Havanna an Bord kamen, da sie ja den Altersdurchschnitt auf dem Schiff erheblich gesenkt hatten. Aber Doris und ich kannten die Jungs nicht, obwohl sie schon vier Mal bei Florian Silbereisen im Fernsehen aufgetreten waren. Aber zum Glück gab es auf dem Schiff doch einige Wissende, die uns schlagermäßig etwas unterbelichteten Banausen auf die Sprünge helfen konnten.
Ich hatte natürlich auch mal in die Show reingeschaut. Mein Eindruck: Fetzige Musik für Party, Oktoberfest, Frühschoppen und ZDF-Fernsehgarten prima geeignet, gepaart mit einer gefälligen, braven Choreographie.
Allerdings würde bei mir persönlich z. B. die etwas andersartige Choreographie beim Bühnenact eines Mick Jaggers, wenn er zusammen mit seinen Kumpels musiziert, etwas mehr Begeisterung hervorrufen. Aber die Rolling Stones würden auf dem Schiff ja den Altersdurchschnitt nicht so senken können.
028. Reisetag - Dienstag, 17.01.2017 - Puerto Limón/Costa Rica
Einen Ausflug in die Natur von Puerto Limón hatten wir bereits vor zwei Jahren absolviert, (siehe Reiseblog 2015 - Eintrag vom 18.3.2015 ). Also hatten wir heute frei.
Am Vormittag streiften wir durch die City von Puerto Limón. Ob man das, was man sah, als mittelamerikanisches pittoreskes Flair oder einfach nur als „alles etwas heruntergekommen“ bezeichnen soll, bleibt jedem selbst überlassen. Nur die moderne Kirche war 1a in Schuss, da bröckelte weder Putz noch Farbe.
In einem touristenfreien Restaurant erhielten wir zum Verzehr einer Cola auch unser vielgeliebtes WLAN und schwupps war Blog Nummer 4 online.
Für den Nachmittag hatten wir den Besuch des kleinen Parks direkt am Hafen auf dem Programm. Vom letzten Besuch wussten wir, dass man hier gut Faultiere beobachten kann, wie sie im Zeitlupentempo sich an den Blättern gütlich tun.. Damals hatte uns ein Einheimischer gegen ein kleines Trinkgeld gezeigt, wo die Tiere in den Bäumen liegen.
Wir selbst taten uns jetzt etwas schwer und sahen nichts, so sehr wir auch den Kopf in den Nacken legten.
Als sich so langsam die Genickstarre einstellt, entdeckte Doris schließlich doch noch ein Exemplar weit oben im Geäst. Leider lag das gute Tier auf den Rücken und war superfaul, denn es bewegte sich die ganze Zeit keinen Millimeter, so dass man hauptsächlich nur den Rücken sah und nur mit einem starken Teleobjektiv nachweisen konnte, dass man nicht lediglich einen im Baum hängenden Putzlappen beobachtet.
Zurück am Schiff angekommen, konnten wir noch ein wenig Maulaffen feilhalten wie neue Lebensmittel und Getränke gebunkert wurden. Es wurde auch wirklich Zeit, denn seit einer Woche waren die „baked beans“ ausgegangen, sodass ich beim Frühstück mein Spiegelei nur noch mit Speck, aber ohne die Bohnen einnehmen musste.
029. Reisetag - Mittwoch, 18.01.2017 - Colón/Panama
Über Colón, einer großen Hafenstadt an der Atlantikseite von Panama war wörtlich im Tagesprogramm zu lesen:
Besondere Vorsicht ist wegen der hohen Kriminalität beim Besuch der Hafenstadt Colón geboten. Es wird dringend davon abgeraten, alleine auf eigene Faust die Stadt Colón und das Hafengelände zu erkunden. Tragen Sie keinen auffälligen Schmuck und lassen Sie Wertsachen aus Sicherheitsgründen an Bord

Natürlich konnte man in Panama original Panamahüte kaufen. Aber tatsächlich hergestellt werden sie in Ecuador
Das machte natürlich keine besondere Lust auf irgendwelche Fahrten in die City. Direkt am Ausgang des Hafens befand sich eine Ansammlung von Geschäften und Restaurants. Dorthin machten wir uns auf, denn es erschien uns ungefährlich und so war es dann auch.
Am Abend kam eine Folkloregruppe an Bord, die auf dem Außendeck am Heck zur Musik vom Band in bunten Kostümen tanzte. Deshalb verließ ich kurz Harry’s Bar um einige Fotos zu schießen. Die Gruppe selbst hat gar nicht bemerkt, dass ich die meiste Zeit nicht da war, denn so ziemlich alle Sitz- und Stehplätze waren von den wahren Folklorefans belegt.
030. Reisetag - Donnerstag, 19.01.2017 - Durchfahrt Panamakanal
Wir lagen noch die ganze Nacht in Colón und früh um 5 Uhr sollten wir ablegen und um 6 Uhr in den Panamakanal einlaufen.
Kanal hin und Kanal her, wir standen wie gewohnt um halb acht auf und hatten gar nicht viel verpasst, nämlich lediglich die Einfahrt in den Kanal selbst. Wir hatten jede Menge Verspätung und konnten sogar noch in Ruhe frühstücken, ehe wir die erste Schleuse erreichten.
In meinem Reiseblog von 2015 über unsere Südamerikareise habe ich ja bereits ausführlich über den Kanal selbst als auch über die Passage berichtet. Damals fuhren wir vom Pazifik in den Atlantik, dieses Mal durchfuhren wir den Kanal in umgekehrter Richtung.
Jetzt könnte ich mich natürlich auf den Standpunkt zurückziehen, man braucht nur den damaligen Eintrag vom 16.3.2015 (10. Blogeintrag) zu lesen, am besten von unten nach oben wegen der umgekehrten Fahrtrichtung und ich kann mir den Bericht sparen. Das tue ich natürlich nicht, aber ganz so ausführlich wird der Beitrag diesmal nicht ausfallen.
Auch würde ich nicht mehr, wie beim letzten Mal fast die gesamten 10 Stunden die die Passage ungefähr dauert, an irgendeiner Reling stehen, mal backbord, mal steuerbord, mal am Heck und mal am Bug. Und auch so viele Fotos brauche ich nicht zu schießen. So zumindest war der Plan.
Um es vorwegzunehmen, ich stand wieder fast die ganze Zeit draußen, abgesehen von einem 15 minütigen Mittagsschläfchen und einer kurzen Mittags- und Kaffeepause. Und die 200 neuen Fotos sind auch nicht gerade wenig, das entspricht nämlich 5 ½ Diafilmen, um es mal in eine veraltete Maßeinheit umzurechnen.
Die Passage hatte auch diesmal nichts von ihrer Faszination verloren.
Der Kanal wurde 1914 fertiggestellt und er verkürzt die Verbindung zwischen Atlantik und Pazifik um 15.000 Kilometer, da die Schiffe nicht mehr um die Südspitze von Südamerika herumfahren müssen.

Treidellok, auch Muli genannt. Über eine Rollenmechanik vorn und hinten werden die Drahtseile in Position gehalten
Zunächst geht die Fahrt „bergauf“ zum Gatunsee. Dabei sind 26 Höhenmeter zu überwinden. Danach geht es wieder „bergab“ zum Pazifik. Sowohl für den Auf- wie für den Abstieg sind Schleusen von Nöten.
Bis Mitte 2016 bestanden die Schleusen aus jeweils zwei parallelen Kammersystemen. Seit dem 26. Juni 2016 wird durch die Kanalerweiterung um ein weiteres Schleusensystem auch Schiffen die Passage ermöglicht, die bisher „zu dick“ für eine Schleusung waren.
Der „Anstieg“ vom Atlantik zum Gatunsee wird durch die Gatun-Schleuse bewerkstelligt, eine 3-Kammer-Schleuse, wobei jede Kammer das Schiff um ca. 9 Meter anhebt.
Der Gatunsee ist ein künstlicher Stausee, der durch den Fluss Río Chagres gespeist wird. Die Hauptaufgaben des Sees sind zum einem die Wasserversorgung von Panama-City und die Bereitstellung des benötigten Wassers für die Schleusungsvorgänge.
Die Schleusung der Schiffe ist in der Tat ein riesen Spektakulum. Drei sogenannte Treidelloks auf jeder Seite halten mit Hilfe von Drahtseilen das Schiff in der Spur, damit es nicht die Schleusenwände schrammt. Eine Havarie in einer Schleusenkammer wäre ein GAU, denn damit wären mit einem male 1/3 der Kanalkapazität verstopft.
Das Anbringen der Stahlseile am Schiff wird nicht einfach von der Schiffscrew durchgeführt, sondern von eigens dafür an Bord gebrachte Mitarbeiter der Kanalgesellschaft, der Autoridad del Canal de Panamá.
Die Einfahrt in und die Ausfahrt der Schiffe aus einer Schleuse erfolgt scheinbar zentimeterweise, jedenfalls sehr sehr langsam und vorsichtig.
Nachdem wir die Gatun-Schleuse verlassen hatten, folgte eine ca. 3-stündige Fahrt auf dem Gatunsee. Auch hier wurde sehr langsam gefahren und das Schiff wurde von einem Schlepper begleitet, der sofort eingreifen würde, falls es Schwierigkeiten geben würde, wie z.B. ein Maschinenausfall.
Das Seeufer des Gatunsees und auch die vielen kleinen Inselchen sind bedeckt von sattem grünem Baumbewuchs, dem Regenwald, ein krasser Gegensatz zu der Technik in und um die Schleusen.
Bis 17.00 Uhr hatten wir dann auch Pedro-Miguel-Schleusen und die Miraflores-Schleusen geschafft, die uns auf das Niveau des Pazifiks heruntergehoben hatten. Man konnte schon die Silhouette von Panama-City erkennen.
Natürlich wurde die Passage begleitet durch die Filmerei des Verrückt-nach-Meer-Teams. Auch unsere Boygroup Feuerherz trat in Aktion. Sie gaben mal vorn, mal hinten am Schiff ein Ständchen, instrumental durch eine Akustikgitarre begleitet, wobei sie Geld für ein Kinderheim, das Inés Chambres in Guayaquil, Ecuador sammelten. Zwar hatten sie einen Panamahut zum Geldeinsammeln dabei, aber da man an Bord gar kein Bargeld bei sich hat, weil man keines braucht (man bezahlt alles bargeldlos), konnte man sich in eine Spendenliste mit Namen und Betrag eintragen und die Spende wurde später vom Bordkonto abgebucht. Clever, clever!
Die Brücke „Puente de las Américas“ die den Kanal überspannt und Panama-City mit dem westlichen Teil des Landes verbindet, markiert das Ende des Kanals bzw. dessen Anfang. Als diese in Sicht kam, betätigte der Kapitän Elmar Mühlenbach ohne Vorwarnung das Schiffshorn, entweder
- aus Freude über die gelungene Passage oder
- um beim Fernsehteam, das auf der Kommandobrückte filmte, anzugeben oder
- weil seine Freundin in Panama-City wohnt und er bei ihr angeben wollte.
Ich weiß es nicht, aber jedenfalls stand ich auf Deck 9 vorne am Bug steuerbordseits und mit dem rechten Ohr der Schallwelle im Weg, die sich vom nahen Nebelhorn ihren Weg nach Panama und die angrenzten Staaten Mittelamrikas bahnte. Das tat richtig weh und ich hatte noch 2 -3 Stunden Spaß mit besagtem Ohr. Beim zweiten und dritten Tut, ich war ja jetzt gewarnt, konnte ich mir dann die Ohren zuhalten.
Typischer Fall von: "Zur falschen Zeit am falschen Ort."
031. Reisetag - Freitag, 20.01.2017 - Seetag/Äquatorüberquerung
Wieder mal ein Seetag, aber diesmal ein besonderer. Wir überquerten den Äquator, ein Ereignis, was auf jedem Kreuzfahrtschiff mit einer besonderen Zeremonie begangen wird - die Äquatortaufe. Dabei betrieben die Phoenix-Leute einen gewaltigen Mummenschanz. Neptun und seine Gattin „reinigen“ die als Gewürm bezeichneten Passagiere mit Rasierschaum (äußerlich) und Wodka (innerlich). Erst wenn man noch einen stinkenden Fisch geküsst hat und schließlich im Pool gebadet hat ist man würdig, den Übergang von der Nord- zur Südhalbkugel zu vollziehen. Zum Glück genügt es auch, der Zeremonie einfach beizuwohnen ohne an ihr teilzunehmen. In meinem Fall hat sogar genügt, Doris zum knipsen einiger Fotos zur Taufe zu schicken, während ich als blinder Passagier in meinem „Büro“, dem Jamaica-Club, ungereinigt die Südhalbkugel betreten habe.
Die ganze Prozedur wird sich übrigens genau so wiederholen, wenn wir am 3. April kurz vor Singapur den Äquator von Süd nach Nord überqueren werden. Dann gibt es auch ein Foto von Neptun - versprochen!
Der Nachmittag wurde genutzt, um noch einmal das Projekt „Inés Chambres“ in Guayaquil“ für das ja gestern schon einmal gesammelt wurde, zu unterstützen.
Bei einem Charité-Lauf auf dem Promenadendeck sponserte Phoenix jede gelaufene Runde (440 Meter) pro Runde und Teilnehmer mit 50 Cent. Startgebühr satte 1 Euro.
Es nahmen etwa 50 Leute Teil, wobei auch einige Phoenix-Mitarbeiter das Feld der Läufer ergänzte. Selbstverständlich war auch das Kamerateam von "Verrückt nach Meer“ vor Ort. Und morgen, wenn wir in Guayaquil eingelaufen sind, wird auch die Spendenübergabe an das Kinderheim „Inés Chambres“ mit Sicherheit filmisch dokumentiert werden und Anfang 2018 wird man es dann im Fernsehen sehen können.
Die Idee und Drehbuch der Spenden-Story stammt von der Produktionsfirma „Bewegte Zeiten“, die „Verrückt nach Meer“ produziert. Wenn auch das meiste, was man in besagter Doku-Soap zu sehen bekommt mit dem wahren Leben und Wirken auf einem Kreuzfahrtschiff sehr wenig zu tun hat, ist die Spendenaktion tatsächlich real und eine gute Sache.
032. Reisetag - Samstag, 21.01.2017 - Manta / Ecuador
Manta ist eine mittelgroße Hafenstadt an der Pazifikküste Ecuadors. Ein großer und wichtiger Wirtschaftszweig dieser Gegend (Provinz Manabí) ist der Fischfang, insbesondere der Thunfischfang. Ein großer Teil der Fischfangflotte ankerte bereits vor Manta und bis zum Nachmittag stieg die Anzahl der Fischerboote und Fischtrawler auf mehr als 100 an.
Das Hafengelände ist sehr weitläufig, gut, dass uns ein Shuttelbus aus dem umzäunten Areal herausbrachte und das auch noch kostenlos. Von der Haltestelle des Shuttlebusses bis zum Stadtstrand waren es nur wenige Gehminuten. Allerdings war kein Badewetter, es nieselte sogar ab und an ein wenig.
In der Touristinfo holten wir uns Rat, wohin man denn mal hin traben könnte.
So kamen wir an einen kleinen Park, wo Markt abgehalten wurde
Auf dem Rückweg durften wir ein interessantes Schauspiel beobachten. Am felsigen Ufer nahmen einige Fischer ihre Beute aus und verfütterten die Fischabfälle an die dort wartenden Pelikane und einige andere Seevögel. Das drollige war, dass die Tiere ganz nahe bei den Fischern geduldig warteten, bis sie etwas abbekamen.
Schon allein für diese Beobachtung hat es sich der heutige Landgang gelohnt. Solche „Zufallserlebnisse“ sind es erst, die so eine Reise interessant machen.
Des Weiteren trafen wir auf einen Saftverkäufer mit seinem Saftpressefahrad; ich weiß nicht, wie man diese Konstruktion sonst noch benenn könnte.
Sowohl der Saftpresser als auch zwei Fischer, die einen größeren Fisch transportierten ließen sich gerne und bereitwillig voller Stolz fotografieren.
Überhaupt machten die Menschen einen freundlichen Eindruck; Straßenhändler und Budenbesitzer, deren Geschäfte mit Sicherheit nicht für die Touristen angelegt sind, grüßten freundlich und fragten, wo man her kommt und wo man hin möchte.
Für den Nachmittag hatten wir einen Bustransfer nach Montechristi gebucht. Nach einer gut halbstündigen Fahrt erreichten wir diesen Ort, der eine Hochburg der Produktion von Panamahüten ist. Der echte Panamahut müsste eigentlich Ecuadorhut heißen, denn hier wird er in Handarbeit hergestellt, geflochten aus einem speziellen Gras, genauer aus dem feinen Toquillastroh des Scheibenblumengewächses Carludovica palmata; so steht es zumindest bei Wikipedia.
Die Preise für solche Hüte liegen zwischen 25 und 1000 Dollar. Je feiner das verwendete Stroh ist, umso teurer wird der Hut. Für die Touristen werden hhauptsächlich Hüte in der Preisklasse bis 100 $ angeboten.
Zur Namensgebung „Panamahut“ sind zwei Versionen im Umlauf.
Die eine Version sagt, dass der amerikanische Präsident Theodore „Teddy“ Roosevelt zur Eröffnung des Panamakanals einen solchen Hut trug und daher der Name rührt.
Da Roosevelt aber bereits für die Bezeichnung des Teddybären berühmt wurde, sollte man eher die zweite Version in Betracht ziehen.
Quelle: Wikipedia
Ich kann mir gut vorstellen, dass Herr Donald Duck, pardon, Donald Trump an dieser Art des Protektionismus seine Freude gehabt hätte und sicherlich überlegt, solche Regelungen wieder einzuführen.
Allerdings haben weder Doris noch ich einen Panamahut erstanden.
Gegen 17.00 Uhr kurz vor dem Ablegen der Artania, strampelte ich im Fitnessraum auf Deck 9 auf dem Ergometer und konnte dabei durch die Großen Scheiben beobachten wie ein Schwarm Fregattvögel, die abendliche Thermik ausnutzend, ihre Kreise zogen, fast ohne jeden Flügelschlag. Dadurch gewann die eher furchtbar langweile Sportaktivität erheblich an Attraktivität und die selbstverordnete halbe Stunde ging sehr viel schneller vorbei.
033. Reisetag - Sonntag, 22.01.2017 Guayaquil/Ecuador
In der Nacht fuhr die Artania in die Mündung des Rio Guayas ein, einem knapp 400 Kilometer langen Fluss. Da zu diesem Zeitpunkt der Fluss etwas weniger Wasser als normal führte und wegen Ebbe die Wassermenge noch niedriger war, musste vorsichtiger navigiert werden, sodass wir mit gut einstündiger Verspätung gegen 8.30 Uhr in Guayaquil, der größten Stadt von Ecuador, ankamen.
Die Artania wurde von einer Folkloregruppe begrüßt, was zur Folge hatte, dass „unsere Seite“ des Promenadendecks von Schaulustigen übervölkert wurde. Es gelang mir dennoch ein Foto zu machen.
Ein größerer Landgang und eine Fahrt in die 12 Kilometer vom Hafen entfernte Stadt war nicht geplant. Zwar ist dort die Uferpromenade ganz hübsch, aber ansonsten gibt es eigentlich, außer diversen Geschäften, die am heutigen Sonntag sowieso geschlossen waren, nicht viel Interessantes zu sehen.
Vor zwei Jahren, als wir schon einmal hier waren, hatte man versucht, Doris das Handy aus dem Rucksack zu stehlen und außerdem machte die Äquatorsonne ihrem Namen alle Ehre, es herrschten 38 Grad im Schatten. Gründe genug einen virtuellen Seetag einzulegen. Wir gingen nur kurz von Bord, da eine Handvoll Verkaufsstände direkt an unserer Pier aufgebaut waren. Ein After Shave Balsam auf Basis von Kakaobutter und ein Kühlschrankmagnet war die Ausbeute. Die Chance, hier noch einen Panamahut zu erstehen, ließen wir ungenutzt verstreichen.
Am Nachmittag kamen die Busse mit den Ausflüglern, die eine Manufaktur für Panamahüte besucht hatten. Spätestens jetzt hatten die Panamahutträger auf dem Schiff die absolute Mehrheit.
034. Reisetag - Montag, 23.01.2017 Seetag
Der heutige Seetag verlief absolut unspektakulär. Am Morgen der Bayerische Frühschoppen mit genau derselben Liedfolge (Playlist) wie bereits am 7.1.2017. Mit „Sierra Matre del Sur“ war dann auch der Höhepunkt erreicht.
Am Abend gab es die Abschiedsgala, weil in 2 Tagen in Callao/Peru die 2. Etappe der Weltreise zu Ende geht. Aber Doris und ich und noch 150 weitere Reisende haben noch 5 weitere Etappen in der Hinterhand.
Mangels weiterer Ereignisse kann ich kurz über meine Spanischkenntnisse referieren, denn in Süd- und Mittelamerika wird wenig Englisch gesprochen und deshalb sind folgende Grundkenntnisse unerlässlich:
- Ola! - hallo!
- buenos dias - Guten Tag
- muchos gracias - vielen Dank
- WiFi - WiFi (= WLAN)
- bano* - Toilette
*gesprochen: banjoh
Mit diesem Wortschatz und einem freundlichen Gesicht kommt man hier schon sehr weit.
035. Reisetag - Dienstag, 24.01.2017 Callao/Peru
Am Vormittag, wir befanden uns noch auf See, schickte ich über das schiffseigene WLAN den 5. Blogeintrag auf die Reise zum Internetserver.
Der aufmerksame Leser wird jetzt einwenden, dass ich schon des Öfteren darüber gejammert habe, dass das WLAN auf der Artania doch sehr teuer sei und die Verbindung zu langsam und instabil ist.
Bezüglich des 2. Teils des Einwands muss ich Abbitte leisten. Es ist ausreichend schnell, vielleicht nicht so schnell, um tagsüber Filme zu streamen, wenn viele Leute auf dem Schiff das Netz nutzen, aber doch schnell genug, um etliche Megabytes an Bildern in einer vernünftigen Zeit hochladen zu können.
Aber teuer ist die Nutzung immer noch. Allerdings ist ein Sponsor aufgetaucht. Ein netter Mitreisender sah mich in meinem „Büro“, dem Spielzimmer „Jamaica Club“ arbeiten und interessierte sich dafür, was ich denn da so treibe. Gerne erzählte ich ihm von meiner Arbeit am Reiseblog. Da er sich ein großes Datenpaket gekauft hatte, konnte er sich am Abend in Ruhe den Blog mal ansehen und hat dann beschlossen, mich dahingehend zu unterstützen, dass ich zwecks Blog-Aktualisierung seinen Artania-Internet-Zugang mitnutzen könne.
Dieses Angebot nahm ich sehr gerne und dankend an
Gegen 13.00 Uhr erreichten wir den Hafen von Callao in Peru. Callao (1 Mio. Einwohner) bildet mit der Hauptstadt Lima (9 Mio. Einwohner) eine urbane Einheit.
Es ist ein riesiger Moloch mit immensen Verkehrsproblemen (Verkehrsinfarkt) gepaart mit großer Armut. Wegen der hohen Kriminalität wurde dringend davon abgeraten, sich in dem Gebiet um den Hafen aufzuhalten und nur mit offiziellen Taxen zu fahren.
Ein Shuttlebus brachte uns zum Hafenausgang, wo wir mal ganz kurz die Nase in die Hafengegend stecken wollten, mit dem sicheren Hafeneingangstor im Rücken.
An der Haltestelle des Shuttlebusses warteten Taxifahrer und Polizei. Sowohl die Taxifahrer als auch die Polizei warnten uns eindringlich zu Fuß weiterzugehen.
Wir nahmen den Ratschlag an, denn die Gegend wirkte wirklich abgerissen und trostlos und es gab aber auch gar nichts, was das touristische Herz erfreuen könnte.
So fuhren mit dem übernächsten Shuttlebus zurück, denn in den nächsten Shuttlebus kamen wir nicht rein, weil sich 2 dynamische Herren, die gerade mit dem Taxi aus Lima zurückgekommen waren, sich so elegant an uns vorbeidrängten und galant die letzten beiden Plätze belegten.
Aus einem früheren Gespräch beim Mittagessen mit diesen Herren, wussten wir, dass sie sehr erfolgreiche Unternehmer waren und jetzt können wir uns auch viel besser vorstellen, wie sie so erfolgreich geworden sind.
Also fuhren wir 10 Minuten später mit dem nächsten Shuttle zum Schiff zurück. Hier gab es auch einige Stände mit Andenken und Textilien und Doris erstand eine sehr hübsche Strickjacke, angeblich Alpaka, aber wir vermuteten auf Grund des Preises und wie es sich anfühlt, dass es reine Baumwolle ist.
036. Reisetag - Mittwoch, 25.01.2017 Callao/Peru
Für heute früh hatten wir bei Phoenix einen Bustransfer nach Lima gebucht. Um halb neun in der Frühe ging es los und das Ziel war die Altstadt von Lima - UNESCO Weltkulturerbe. Hier sei auch der Tourist sicher, lediglich vor Taschendieben wird gewarnt.
Die Busfahrt dauerte für die Strecke von ca. 12 KM eine gute Stunde. Die meisten Gebäude an denen wir vorbeifuhren waren in einem mehr oder weniger jämmerlichen Zustand. Für Instandhaltung und Wartung scheint das Geld zu fehlen und so verkommen die Gebäude natürlich mit der Zeit.
Die Altstadt selbst mit ihren beiden markanten Plätzen Plaza de Armas und Plaza San Martin ist top gepflegt und restauriert. Zwischen den beiden Plätzen verläuft eine Fußgängerzone mit modernen Geschäften (überdurchschnittlich viele Schuhgeschäfte).
Auffällig ist die große Polizeipräsenz. Über den Platz verteilt ist mindestens eine Hundertschaft im Einsatz und zwar im vollen Ornat.
In einer Seitenstraße stießen wir auf ein Internetcafe, wo man für wenige Centimos (1 Sol = 100 Centimos) die dortigen PCs hätte benutzen können, wenn man denn Cintimos gehabt hätte. Wir konnten mit unserem 1-Dollarschein noch so wedeln, das Mädel an der Kasse zeigte sich unbeeindruckt.
Ein paar Meter weiter an einem kleinen Souvenirstand erstanden jeder von uns zwei Patches mit der Flagge von Peru und Ecuador (dort hatten wir keine Patches gefunden). Hier konnten wir mit Dollar bezahlen und ließen uns das Wechselgeld in peruanische Talern zurückgeben. Mit den 3 Sol (der Gegenwert von einem Dollar) in der Tasche ging es schnurstracks zurück ins Internetcafe, wo wir stolz jeder einen PC besetzten, unsere Mails checkten und in Summe 1 Sol bezahlen mussten.
Jetzt war es noch dringend nötig und an der Zeit, unsere Sprachkenntnisse anzuwenden und fragten in einem kleinen Restaurant nach „bano“. Der aufmerksame Leser weiß natürlich schon, dass dies das spanische Wort für Toilette ist (siehe auch Eintrag vom 23.1.2017). Freundlich aber bestimmt machte uns der man hinter dem Tresen klar: „jederzeit gerne, kostet aber 1 Sol“. Bereitwillig gab ihm Doris den vorletzten unsere noch übrigen zwei Peru-Talern. Es gelang dem Mann hinterm Tresen trotz Sprachbarriere sehr deutlich klar zu machen, dass der Tarif 1 Sol pro Person betrage. Was lernen wir daraus? Internetsurfen ist um vieles preiswerter als Bano-Nutzung. Nachdem wir vom bano kamen, waren wir heilfroh, im besagten Restaurant nicht auch noch essen zu müssen.
Wir schauten uns noch ein wenig in der Altstadt um, dann brachte uns der Bus auch schon wieder zurück zum Schiff - natürlich rechtzeitig zum Mittagessen, da ist Phoenix sehr zuverlässig.
Heute ging eine weitere Etappe zu Ende. Das bedeutet Passagierwechsel und damit viel Arbeit und Hektik für die Kabinenstewards und die Reiseleitung. Wir sogenannten Transitpassagiere, das sind die, die auch noch die nächste Runde mitfahren,konnten dem hektischen Treiben in Ruhe zusehen und dem Start der 3. Etappe entgegensehen, die von Phoenix den Namen „Südseeträume zwischen Peru & Neuseeland“ erhalten hat.
037. Reisetag - Donnerstag, 26.01.2017 Callao/Peru
Wir lagen noch einen halben Tag hier in Callao, zu kurz, um noch etwas zu unternehmen.
Für 12.45 Uhr wurde die Rettungsübung angesetzt. Es gilt gegenüber vor zwei Jahren eine neue Regelung, dass vor der Abfahrt des Schiffes für die neuen Passagiere die Rettungsübung angesetzt werden muss. Vorher genügte es, die Übung innerhalb 24 Stunden nach dem Ablegen durchzuführen.
Obwohl wir die Übungen schon in Genua und Havanna absolviert hatten, war auch dieses Mal unsere Teilnahme Pflicht. Und so wurden wir wieder darin unterwiesen, wie man die Schwimmweste anlegt, wo die Sammelpunkte sind und wo das uns zugedachte Rettungsboot zu finden ist, eine Prozedur, die eine gute halbe Stunde in Anspruch nimmt und zum größten Teil aus Warten besteht.
Angeblich liegt es in Entscheidung des Kapitäns und/oder des Sicherheitsoffiziers, ob die Transferpassagiere die Rettungsübung wiederholen müssen oder nicht. Na ja, schaden tut es ja keinen Fall.
Allerdings gingen durch den unglücklichen Zeitpunkt der Übung dann alle 850 Passagiere gleichzeitig zum Mittagessen. Im Lido, dem Selbstbedienungsrestaurant, bildeten sich endlose Schlangen vor der Essensausgabe. Bei der Suppe, am Salatbuffet und an der Eisstation gab es allerdings die Chance auf ein Durchkommen und so ergab sich die Zusammenstellung meines Mittagsmenüs praktisch ganz automatisch.
Um 14.30 Uhr legten wir ab, vorbei an den unzähligen Fischerbooten, die vor der Hafeneinfahrt ankerten, um Südwestkurs einzuschlagen, Richtung Südsee und dem nächsten Ziel, die Osterinsel. Hierfür werden wir viereinhalb Tage brauchen.
Am späteren Abend wurde ich in Harry’s Bar "gefunden". Gesucht hatten mich zwei Leute aus dem Internetforum http://www.kreuzfahrtinfos.at/forum/, die in Callao zugestiegen waren, Katharina und Chris. Zwei andere Leute aus diesem Forum sind in diesem Blog ganz am Anfang in Erscheinung getreten. Sie hatten nämlich wunderschöne Routenkarten für jede einzelne Etappe angefertigt, die unter dem Menüpunkt „Route und Schiff“ und Untermenüpunkt „Die Route“ zu finden sind. Ein Blick dorthin lohnt sich auf alle Fälle.
Und in diesem Forum treiben sich auch Katharina und Chris rum, sind auf meinen Blog gestoßen und haben ihn wohl auch gründlich gelesen, denn sie wussten ja, dass ich abends in Harry’s Bar zu finden bin.
038. Reisetag - Freitag, 27.01.2017 Seetag
Für den heutigen und die folgenden drei Seetage mussten die Passagiere beschäftigt und bei Laune gehalten werden.
So fand am Vormittag mal wieder der fischlastige Maritime Frühschoppen statt und der Abend stand unter dem Motto „Willkommensgala“, Kleidungsvorschlag natürlich: „elegant“.
Die Galaabende haben dadurch ein wenig ihren Schrecken verloren, dass man im Selbstbedienungsrestaurant Lido, wo wir immer speisen, nicht mehr das Steak so essen muss, wie es aus der Küche kommt, nämlich halbroh, sondern dass sie ein Koch auf Wunsch etwas mehr in Richtung „well done“ nachbessert.
039. Reisetag - Samstag, 28.01.2017 Seetag
Heute keine besonderen Vorkommnisse, deshalb stelle ich einfach mal das 4-seitige Tagesprogramm als PDF zum Download zur Verfügung. So kann man sich gut einen Eindruck verschaffen, wie man sich an Bord bespaßen und beschäftigen lassen kann.
040. Reisetag - Sonntag, 29.01.2017 Seetag
Brot und Spiele, unter dieses Motto könnte man die heutigen Goodies sehen.
Zum Frühstück konnte man sich ein kleines Steak in die Pfanne hauen lassen (ich bin aber trotzdem bei meinem Spiegelei geblieben) und am späten Vormittag stand die große Bord-Olympiade auf dem Programm.
Bei der Olympiade traten folgende 4 Mannschaften an, wobei ein Team sich jeweils aus einer Auswahl folgender Spezies zusammensetzte
- Phoenix Reiseleitung
- Offiziere
- Crew
- Passagiere
Die Wettbewerbe selbst setzte sich aus diversen Geschicklichkeitsspielen zusammen, so eine Art Eierlaufen und Kindergeburtstag für Erwachsene. Die Offiziere haben schließlich standesgemäß gewonnen.
041. Reisetag - Montag, 30.01.2017 Seetag
Da morgen die Osterinsel, ein Höhepunkt dieser Südseeetappe, angelaufen werden soll, hatte ich heute einen Schontag eingelegt. Es hatte mich nämlich schon seit einigen Tage die traditionelle Kreuzfahrterkältung erwischt. Die geht mit leichten Halsschmerzen los, dann kommt ein trockener Husten dazu, man kann keine Bäume mehr ausreisen, muss aber auch nicht das Bett hüten. Doris hatte dieses absolute Muss einer jeden längeren Kreuzfahrt schon vor einigen Tagen erfolgreich abgeschlossen.
042. Reisetag - Dienstag, 31.01.2017 Osterinsel/Chile
Als Junge hatte ich den 60er Jahren im Fernsehen einen Dokumentarfilm von Thor Heyerdahl über seine Expedition auf die Osterinsel und über die dortigen steinernen Figuren der sogenannten Langohrmenschen gesehen. Das hatte mich unheimlich fasziniert und heute, ca. 50 Jahre später, liefen wir die Insel an.
Seit 1995 ist die Osterinsel als Nationalpark Rapa Nui Teil des UNESCO-Welterbes.
Ein entsprechender Ausflug war gebucht, nicht gerade billig, denn alleine schon der „Eintritt“ in den Nationalpark beträgt 80 US-Dollar pro Person, dazu kommen dann noch die 70 Dollar für den Ausflug selbst, aber es gibt ja auch einiges zu sehen.
Um 7.00 Uhr erreichten wir die Insel, die zu Chile gehört. Sie ist 3.500 Kilometer vom Festland und 4000 Kilometer von Tahiti entfernt, also wirklich sehr sehr einsam gelegen.
Vor der der südwestlichen Spitze, bei Hanga Roa, der einzigen Ortschaft der Insel, wurde der Anker geworfen.
Bis kurz vor acht gab es keinerlei Durchsagen und Information, das ließ nichts Gutes vermuten.

Und dann drehten sie uns auch noch den Rücken zu, die Figuren mit ihren langen Ohren und den hohen Hüten.
Und dann kam sie auch schon die Hiobsbotschaft. Wegen zu starker Brandung war eine Anlandung mit den Tenderbooten nicht möglich.
Aber es gab einen Plan B. Anker hoch und in einer guten Stunde erreichten wir Im Norden der Insel die Anakena Bucht. Dort wurde von den Osterinsulanern ein schwimmender Ponton als provisorischer Anlegesteg installiert und das Tenderboot machte zur Probe eine Leerfahrt dorthin, das heißt, es wurde versucht, dorthin zu kommen. Aber auch das misslang, die Wellen waren zu hoch und das Tenderboot war ein Spielball derselben, eine Anlandung also viel zu gefährlich.

Hier wäre unser Ausflug hingegangen, zum Steinbruch, wo die Figuren hergestellt wurden. Trotz 30-fachem Zoom - besser konnte man die unzähligen fertigen und halbfertigen Moai nicht einfangen.
Also das Ganze retour zur ersten Anlegestelle, mit der klitzekleinen Hoffnung, dass sich dort die Lage verbessert hat. Hatte sie aber nicht, im Gegenteil, die Brandung war noch stärker geworden.
Also blieb nichts anderes übrig, als mit der Artania langsam die Insel einmal zu umrunden, um wenigsten von der Reling aus einen kleinen Eindruck von der Osterinsel zu bekommen und mit dem Fernglas oder dem Teleobjektiv zumindest einen Blick auf die Moai werfen zu können.
Die Moai sind die anfangs erwähnten Steinfiguren, die einzeln oder in Gruppen auf einer steineren Plattform stehen. Solch ein Ensemble aus Plattform und Figuren wird Ahu genannt.
Trotz umfangreicher Forschungen ist ihr eigentlicher Zweck und die genaue Zeit ihrer Errichtung unter den Experten immer noch umstritten. Auch weiß man nicht, mit welcher Technik die bis zu 10 Meter hohen und mehrere Tonnen schweren Figuren vom Steinbruch, wo sie herausgearbeitet wurden, über die gesamte 162,5 km² große Insel verteilt worden sind.
All das macht dem Mythos der Osterinsel aus und die Enttäuschung, dort nicht anlanden zu können war natürlich groß.

Während der Inselrundfahrt konnte man auch die Landebahn sehen. Sie wurde von den Amerikanern ausgebaut, weil sie hier mitten im Pazifik eine Notlandebahn für ihre Spaceshuttle-Raumfähren brauchten
Gegen 16.00 Uhr war die „Inselrundfahrt“ der besonderen Art mit der Artania zu Ende und wir nahmen Westkurs auf zum nächstgelegene bewohnte Eiland, nämlich Pitcairn, in einer Entfernung von 2078 Kilometern. Hierfür werden wir zwei volle Tage benötigen.
Als kleines Trostpflaster wurde am späten Nachmittag an der Phoenixbar am hinteren Außendeck noch eine sogenannte Trost-Party gestartet. Es gab Austern und Sekt und fröhliche Musik vom Band.
Da weder Doris noch ich mit Austern etwas anfangen können, geschweige sie denn essen, war der Trostfaktor eher gering.
043. Reisetag - Mittwoch, 01.02.2017 Seetag

Auf Kanal 1 im Bordfernsehen wird laufend die aktuelle Position der Artania angezeigt und zwar abwechselnd auf Karten in den verschiedensten Maßstäben. Hier die ganz globale Ansicht.
Man beachte den kleinen Kreis mitten im Pazifik - das sind wir!
(Am besten ein Klick auf’s Bild. Dann wird es in voller Größe angezeigt und man sieht den kleinen Kringel besser.)
Die heutige Kaffeestunde stand unter dem Motto „Alles Schokolade“. Das bedeutete Schokobrunnen, schokolastiges Kuchenangebot, schöne Deko usw. Ich war auch da. „Nur mal gucken!“ lautet jedes Mal die Ausrede, wenn man hingeht. Dieses Mal blieb ich allerdings relative standhaft und griff nach einem der Mettbrötchen mit Zwiebeln, die auf einem etwas verschämt abseits stehenden Tischchen als Alternative zur süßen Schokowelt zu finden waren.
Für den späteren Abend um 22.30 Uhr kündigte das Tagesprogramm an:
Von Liverpool über Hamburg…
Die Beatles auf dem Weg zum Weltruhm!
Eine Multimediashow mit den Stationen über ihre einzigartige Karriere.
Für mich als eingefleischter Beatles-Fan war das natürlich eine absolute Pflichtveranstaltung. Kurzum es war ganz nett. Neue Erkenntnisse konnte mir der Moderator nicht vermitteln, aber die Mitschnitten von Fernsehshows und den Ausschnitten aus den Spielfilmen „Help“ und „A Hard Days Night“ auf der großen Leinwand habe ich mir gerne noch einmal angeschaut. Es gab sogar Clips, die ich bisher noch gar nicht kannte.
Eine nette Abendveranstaltung, allerdings bemängelte einige Leute, dass keine Stimmung aufkam. Das ist vollkommen richtig, es war eben mehr ein Lektorat als eine Rock-Veranstaltung. Da hat es auch nichts genutzt, dass wir alle zum Schluss „Let it be“ mitsingen sollten. Ich glaube ich war auch der einzige, der mitgesungen hat.
044. Reisetag - Donnerstag, 02.02.2017 Seetag
Außer dem Weißwurstessen von 11.00 - 11.59 Uhr und dem Captain-Cook-Abendessen gab es heute keine Sensationen hier auf dem Schiff.
Hinter dem Captain-Cook-Essen verbarg sich eine galaähnliche Menüfolge, wobei jedem Gang auf der Speisekarte willkürlich ein Datum aus dem ereignisreichem leben des Entdeckers Cook zugeordnet wurde. Der Nachtisch war schließlich seinem Todestag am 14.2.1779 gewidmet.
Ich erspare mir hier jetzt jeden weiteren Kommentar und bringe auch nicht ein Foto von Statler Waldorf
Vor einem der Restaurants wurde dekorativ ein kleiner Kahn aufgebaut und dekoriert und zwar mit genau den Utensilien wie vor etwa 3 Wochen beim Piraten-Abendessen, was im Blog bisher gar nicht besonders erwähnt hatte.
Eine nette Geschichte am Rande dieses Abendessens:
Zu solchen Eventabendessen kommen auch die Bordfotografen in die Restaurants, diesmal mit einem grimmig dreiblickenden Piraten im Schlepptau. Der Pirat, mit einem Vorderlader bewaffnet, stellt sich hinter einen speisenden Gast, während der Fotograf diese bedrohliche Situation im Bild festhält (6 €, wenn man es dann tatsächlich kauft).
Wir saßen mit einem Ehepaar, mit denen wir uns angefreundet haben an einem 4er-Tisch und als die Fotosession am Tisch fertig war, beschwerte sich unser Tischgenosse beim Piraten: „Bitte, warum haben Sie meine Frau jetzt nicht erschossen?“ Das Gelächter bei uns und an den Nachbartischen war entsprechend.
045. Reisetag - Freitag, 03.02.2017 Pitcairn/Bounty Bay/Großbritannien
Diese relative unbedeutende Insel mit gerade mal 44 Einwohnern besitzt einen besonderen Mythos. Hier landeten und versteckten sich 1790 die Meuterer von der Bounty und deren Nachfahren leben hier immer noch
Pitcairn Island ist das letzte britische Überseegebiet. Verwaltungstechnisch wird die Insel von Neuseeland betreut.
Nach der Pleite mit der Osterinsel war es auf dem Schiff Gesprächsthema Nummer 1, ob wir wenigsten hier anlanden können oder nicht. Wenn eine Anlandung überhaupt möglich sein sollte, dann nicht mit den schiffseigenen tenderbooten, sondern mit langen flachen Holzbooten der Einheimischen, die dann Transfer zum Land übernehmen würden.
Im Tagesprogramm wurde von der Reiseleitung jegliche Verantwortung für dieses Tendern abgelehnt, da der Einstieg in die Boote über eine Jakobsleiter eine sehr sportliche Angelegenheit sei.
Um es kurz zu machen, jegliche Überlegung „soll ich, soll ich nicht“ war hinfällig, denn auch hier war Brandung und Schwall so stark, dass sogar die Einheimischen von einem Landgang abrieten.
Was man den Passagieren weder zumuten wollte, noch zutraute, war für die Bounty-Nachfolger kein Thema. Sie kamen mit zwei Booten und brachten somit 90% der Bevölkerung an Bord der Artania, bepackt wie die Maulesel, denn sie bauten auf dem Achterdeck einen kleinen Basar auf, wo man T-Shirts, Schmuck, Holzschnitzereien, Briefmarken, Münzen und Honig, der von ausordentlichen Qualität sein soll, kaufen konnte.
Das mit dem Kauf stellte sich allerdings sehr schwierig dar, da gefühlt so ziemlich alle 850 Passagiere gleichzeitig die Verkaufsstände zu umlagern schienen.
Doris und ich gingen unsere Einkaufstour gelassen an, denn wir warteten einfach bis 12.30 Uhr, dem Zeitpunkt wo die Restaurants für das Mittagessen öffneten. So konnten wir stressfrei ein Glas Honig kaufen und in Ruhe einen Kühlschrankmagneten und 2 Aufnäher aussuchen.
Von der Möglichkeit, uns für 10 US-Dollar einen offiziellen Stempel von Pitcairn in den Reisepass stempeln zu lassen, machten wir allerdings keinen Gebrauch. Die Geschäfte dieses mobilen „Passamtes“ sollen dem Hörensagen nach aber recht gut gewesen sein.
Als Entschädigung für den erneut missglückten Landgang gab es wiedereine „Inselrundfahrt“ mit der Artania. Anschließend verließen uns die Bounty-Leute wieder und wir nahmen Kurs auf das Tuamotu Atoll. Und wie hier im Pazifik üblich, sind die Entfernungen groß und die Inseln klein. Wir werden also erstmal wieder gut zwei Tage unterwegs sein

Zumindest per Powerpoint-Präsentation gelangten wir auf Pitcairn.
Ein "Bounty-Nachfahre" hielt einen kleinen Vortrag über das Leben auf der Insel
046. Reisetag - Samstag, 04.02.2017 Seetag
Die Personenwaage im Fitnessraum ist gesichert wie die Bank von England, mit einer schwereren Kette wie ein Galeerensträfling fest mit der Wand verbunden. Trotzdem war sie auf einmal nicht mehr da. Eine investigative Recherchen hat ergeben, dass sie zwecks eines Batteriewechsels abgeholt wurde und in den nächsten Tagen sich wird an ihrem Platz sein wird.
Dieser technische Prozess erinnert mich stark an eine Zirkusnummer. Ein Clown will auf dem Klavier spielen, aber der Klavierhocker ist zu weit vom Instrument entfernt. Der Clown versucht das Problem dadurch zu lösen, dass er das Klavier näher an den Hocker schieben möchte.
Am Nachmittag wurde ein Eheversprechen wiederholt. Nein, nicht von Doris und mir, sondern von einem Pärchen, das vor zehn Jahren geheiratet hat und nun ein entsprechendes Arrangement bei Phoenix gebucht hatte. Wir haben nur dadurch davon erfahren, dass wir die beiden kennengelernt hatten. So erfuhren wir, dass die Zeremonie auf der Kommandobrücke stattfand, Der Kreuzfahrtdirektor Thomas Gleis eine schöne Rede gehalten hat und seine Gattin, Kathrin Gleis-Wiedemann sehr ergreifend gesungen hätte, dass die Braut die Tränen nicht mehr zurückhalten konnte. Zum Schluss hat der Kapitän die Trauformel gesprochen und das Paar wiederholte ihr Jawort und die Beiden durften einmal den Knopf für die laute Schiffstute drücken.
Die Kabine der beiden war ganz in Rot dekoriert und im Restaurant war ein besonders aufwendig dekorierter Tisch für das Paar und Gäste reserviert.

Es gibt FotografInnen, die machen aber auch vor Garnichts halt! Ich war nur ganz kurz mal eingenickt, da wurde dieses Foto ohne mein ausdrückliches Einverständnis von Doris geschossen. :-)
Bei besten Wetter genoss man diesen Seetag, indem man sich ein ruhiges schattiges Plätzchen suchte (und auch fand), während die ersten Südsee-Atolle gesichtet wurden.
047. Reisetag - Sonntag, 05.02.2017 Seetag
Heute war ein fauler Tag. Außer einer halben Stunde im Fitnessraum war faulenzen angesagt. Am Nachmittag suchte ich mir auf der Steuerbordseite auf dem Promenadendeck ein ruhiges, schattiges Plätzchen, um zu lesen. Wie gefährlich die Sonne um diese Zeit (hier ist Hochsommer) am südlichen Wendekreis ist, merkte ich am Abend. Ich hatte mir im Schatten einen Sonnenbrand im Gesicht geholt, sodass ich schöner aussah als Winnetou in seinen besten Zeiten.
048. Reisetag - Montag, 06.02.2017 Fakarava (Tuamotno-Archipel)/Französisch Polynesien
Nachdem wir 10 Tage keinen Fuß mehr auf festen Boden gesetzt hatten, war das gesamte Schiff heiß darauf, unsere erste Südseeinsel zu betreten.
Der ersehnten Landgang setzte allerdings eine Tenderbootfahrt voraus, denn wir lagen auf Reede. Da von Phoenix keinerlei Landausflüge angeboten wurden, galt für alle Passagiere „freier Landgang“. Das Tendern war deshalb dahingehend organisiert, dass es einen „kabinenbezogenen“ Fahrplan gab, also erst alle von Deck vier und 8, dann Deck 7 und 2 usw. Da aber nicht kontrolliert wurde, ob Zeitpunkt und „Wohnort“ zum Fahrplan passte, war die Auslastung nicht gleichmäßig, sondern gegen 9.30 Uhr wollte das halbe Schiff gleichzeitig an Land.
Da große Menschenansammlungen meist mit Stress, Hauen und Stechen verbunden sind, warteten wir einfach noch ein wenig ab und fuhren um halb elf ohne große Wartezeit und keinerlei Drängelei an Land zum Ort Rotoava.
Rotova ist ein Ort auf der Insel Fakarava. Fakarava wiederum gehört zu einem Atoll. Ein Atoll wird von einem Saum ringförmig angeordneten Inseln gebildet. Den inneren Teil dieses Rings bezeichnet man als Lagune. Der Tuamotno-Archipel wiederum besteht aus einer Gruppe von 78 Atollen, die sich über eine Länge von 2000 Kilometern hinziehen.
Das Tuamotno-Archipel wiederum gehört politisch zu Französisch Polynesien, das eine Gesamtfläche. von etwa 4.000.000 km2 besitzt, wobei die Landfläche aber nur etwas mehr als 4000 km2 beträgt.
So, jetzt sind die Begrifflichkeiten erst mal geklärt!
Dort wo wir auf Fakarava mit dem Tenderboot anlandeten, ist die Insel sehr schmal, vielleicht 300 bis 500 Meter. In der Lagune selbst, also innerhalb des Atollrings ist die See ruhig und man kann gefahrlos baden, während auf der anderen Seite der Insel, also am äußeren Teil des Rings, die Brandung sehr stark ist und auch wegen der Unterströmungen baden gefährlich ist. Mit diesem Warnhinweis von der Reiseleitung im Gepäck betraten wir endlich Land.
Am Tendersteg wurde jeder Ankömmling erst mal eine kleine Blüte, die man sich hinter das Ohr steckte, begrüßt. Eine Trommlergruppe sorgte für weiteres Südsee-Feeling und wir machten und auf den Weg, einen kleinen Teil der Insel zu Fuß zu erkunden. Verlaufen konnte man sich ja nicht, es gab nur eine einzige Straße am Rand der Lagune, aber man konnte auch mal schnell zur anderen Seite, zum Außenriff wechseln, um zu prüfen, ob das mit der starken Brandung auch stimmt.
Hauptsächlich Palmenhaine, aber auch Mischwälder, eigentlich eher Baumgruppen, wechselten sich ab mit kleinen Häusern und Hütten und einigen wenigen Geschäften.
Überall gab es winzige Strandabschnitte, wo sich die „Artanier“ niederließen, um in der Lagune zu baden. Die Strände waren keine Sandstrände, sondern grasbewachsen und die Bäume spendeten wunderbar Schatten. Doris und ich zogen es vor, uns nicht unter eine Kokospalme zu legen, denn die überall herumliegenden Kokosnüsse, sind ja irgendwann mal von den Palmen heruntergefallen und haben sich nicht darum gekümmert ob dort jemand liegt oder nicht. Aber wie bereits erwähnt, gab es ja auch weniger gefährliche Bäume und solch einen nutzten wir, um uns nach dem ersten Kilometer Inselbesichtigung erst mal auszuruhen und auch die Füße mal ins Wasser zu halten.
Wichtig hierbei war es, Badeschuhe anzuziehen, denn die Insel ist ein Korallenriff und Korallen und Steine sind der natürliche Feind eines jeden baren Fußes.
Nach der ausgiebigen Pause wanderten wir weiter, bei 30 Grad im Schatten. Als dann plötzlich ein Lokal auftauchte, in dem auch noch Bekannte von uns kühle Drinks genossen, war wieder Pause angesagt. Eine kleine Dose Bier für 5 Dollar und eine Cola für 4 Dollar waren jetzt nicht gerade Schnäppchenpreise, aber die Hitze und mangelnde Alternativangebote, ließen uns kaum eine andere Wahl, denn in diesem Moment war die Flasche lauwarmes Wasser, die wir in unseren Rucksäcken mitführten, wenig verlockend.
Wurden früher die Eingeborenen von den Weißen mit bunten Glasperlen bei den Tauschgeschäften über den Tisch gezogen, so könnte man die Preisgestaltung in diesem Lokal durchaus als späte Rache ansehen und war somit vollkommen in Ordnung, zumal es auch noch freies WLAN gab.
Auf dem Rückweg trafen wir noch auf wirklich sehr exotisch aussehende Folkloremusiker, die mit ihrer Musik die Leute anlockten, um Ihnen gekühlte Kokosnüsse mit Loch und Strohhalm zu verkaufen, eine schmackhafte Erfrischung.
Um 15.00 Uhr waren wir dann wieder an Bord und eine Stunde später legten wir ab.
Die Zeit der faulen Seetage war jetzt erstmal vorbei. Für die nächsten vier Tage waren Landgänge angesagt. Und da Lagunen ruhig und geschützt liegen und dort unsere Ankerplätze sein werden, ist auch nicht mehr mit Ausfällen zu rechnen.
049. Reisetag - Dienstag, 07.02.2017 Rangiroa (Tuamotno-Archipel)/Französisch Polynesien
Rangiroa ist ein Atoll mit ca. 2300 Einwohnern. Durch die enge Einfahrt gelangte die Artania in die Lagune des Atolls und warf gegen 7.00 Uhr den Anker.
Für den frühen Nachmittag stand ein Schnorchelausflug auf dem Programm.
Die Tenderfahrt an Land war dieses Mal deshalb etwas Besonderes, da wir nur etwas mehr als 10 Leute waren - ein Luxus gegenüber der dort sonst herrschenden Enge.
Am gleichen Steg, wo der Tender anlegte, wartete unser Boot, das uns zum Schnorchelrevier bringen sollte. Auch hier gab es keine Massenparty, sondern es blieb bei den ca. 10 Leuten.
Die Ausflugsbeschreibung hatte vielsagend versprochen:
Mit einem kleinen Boot fahren Sie durch das kristallklare Wasser zu einer Stelle am Riff, die Aquarium genannt wird. Dies ist eines der besten Schnorchelgebiete des Atolls. Hier können Sie farbenfrohe Fische und Korallen bewundern.
Und oh Wunder, die Beschreibung stimmte bzw. war sogar eher untertrieben.
Es geschah immer wieder, dass man sich auf einmal inmitten eines Schwarms von vielleicht 500 oder mehr exotischen Fischen befand, etwa 20 bis 30 Zentimeter groß mit leuchtenden orangenen Zeichnungen. Obwohl die Fische nur wenige Zentimeter von einem entfernt waren, es ist mir nie gelungen, einen auch mal anzufassen, denn sie waren immer einen Tikk schneller als ich mit meiner Hand. Meinen Mitschnorchlern ist es übrigens genauso ergangen.
Neben diesen großen Fischschwärmen gab es eine große Anzahl bunter Fische in allen Farben und Größen, auch einige Riffhaie, etwa ein bis anderthalb Meter lang. Sie zogen ruhig ihre Bahnen, meist etwas 2 Meter unter der Wasseroberfläche. Man hatte uns gesagt, dass diese Tiere zwar keine Vegetarier seien, aber viel zu klein, um den Menschen gefährlich zu werden. So hielten sowohl die Haie vor Doris und mir als auch wir vor den Haien immer einen respektvollen Abstand
Die knappe Stunde Zeit, die uns zum Schnorcheln zugestanden wurde, waren gefühlt nicht länger als 10 Minuten. Wow, der Ausflug hatte sich gelohnt.
Gegen 17 Uhr wurde der Anker gelichtet und wir nahmen Kurs auf unser nächstes Ziel Moorea.
50.Reisetag - Mittwoch, 08.02.2017 Moorea und Papeete/Französisch Polynesienende
Eine Stunde nach Sonnenaufgang, gegen 7.00 Uhr, erreichten wir unseren Ankerplatz vor der Insel Moorea. Moorea ist von vulkanischem Ursprung und gegenübe den bisher besuchten Inseln nicht flach, sondern gebirgig. Die höchste Erhebung, der Mont Tohiea hat eine Höhe von immerhin 1207 Metern. Moorea hat eine Fläche von 133 km² und rund 16.000 Einwohner.
Für den Nachmittag hatten wir eine Schnorchelsafari gebucht. Safari und nicht einfach Ausflug hieß die Tour wohl deshalb, weil sie etwas länger dauern sollte als die gestrige und nicht nur an einer, sondern an zwei Stellen getaucht werden sollte.
Gegenüber gestern war das Boot auch größer. Mit insgesamt 35 Leuten fuhren wir los. Beim ersten Stopp, dem sogenannten „Stringray Paradise“ hatten Einheimische zahme Stachelrochen aufgezogen.
Man konnte beim Schnorcheln die Tiere auch anfassen, allerdings nur auf der Oberseite, wie man uns eingeschärft hatte. Und im Gegensatz zu den Fischen von gestern, hatten sie tatsächlich keine Berührungsängste. Sie fühlten sich weich und etwas schleimig an.
Als Zugabe kreiste hier auch noch ein Schwarm Haie, die aber auch hier ungefährlich sein sollen. Und tatsächlich haben wir auch alle überlebt. Wir, die Schnorchler, waren ja auch in der Überzahl. Und da sich das ganze Schauspiel nur in einem relativ kleinen Umkreis bei hüfthoher Wassertiefe abspielte, hatte das Ganze auch eher das Flair einer belebten Fußgängerzone und war von einem stillen Naturerlebnis doch etwas entfernt.
Aber interessant und spannend war es trotzdem.

"Das ist ein Stachelrochen". Kleine Vorführung für diejenigen, die sich hier nicht ins Wasser trauten
Der zweite Stopp fand vor einer kleinen Insel, einem sogenannte Motu, statt. Hier sollte man an einem Korallenriff beim Schnorcheln farbenfrohe Fische beobachten können. Allerdings war auch hier das Wasser nur hüfttief.
Und dort, wo die Korallen anfingen, wurde es auch nicht sehr viel tiefer. Das war zum Schwimmen nicht ungefährlich, da man sich dabei leicht an die Korallen verletzen konnte. Und Verletzungen durch Korallen heilen sehr schlecht. Kurzum, dieses Revier war zum Schnorcheln denkbar ungeeignet. So blieb dem Meisten von uns die versprochene farbenfrohe Fischvielfalt vorenthalten. Man schwamm als vor dem eigentlichen Riff ein wenig hin und her und sah tatsächlich auch den ein oder anderen Fisch, aber wir waren ja seit gestern viel Besseres gewöhnt und daher etwas enttäuscht.
Während unseres Aufenthalts im Wasser hatte der Bootsführer und seine zwei Helfer mitgebrachte Früchte in mundgerechte Portionshäppchen geschnitten und auf einer Platte nett präsentiert und man konnte sich davon etwas nehmen. Passionsfrucht, Mango, Ananas und Banane mit frischen Kokosraspeln garniert. Ich habe noch nie in meinem Leben so schmackhafte Früchte gegessen wie hier. Der Ärger über das miese Schnorchelrevier war verflogen.
Und zu allem Überfluss, hatte ich auch noch den strategisch besten Platz im Boot, nämlich im hinteren Teil genau vor der Früchte-Platte. Und da die meisten Leute, nachdem sie davon probiert hatten, zurück auf ihre Plätze mussten, um sich abzutrocknen, umzuziehen, um nasse Badesachen zu verstauen, keine Zeit und weiteres Interesse dafür hatten, war noch jede Menge dieser Köstlichkeiten übrig. Und hier kam mein strategischer Platzvorteil zum Tragen. De Bootführer forderte mich immer wieder auf, zuzugreifen und so griff ich immer wieder zu und hatte mich zum Schluss so richtig mit den Früchten vollgestopft und war rundherum zufrieden.
Auf der Rückfahrt zur Tenderpier konnte man noch den herrlichen Ausblick auf die grüne Berglandschaft genießen - Südsee satt!.

Die Übernachtung in einem dieser ins Wasser gebauten Bungalows kostet schlappe 800 Euro pro Nacht (pro Person)
Um 18:00 Uhr legte die Artania ab und erreichten 2 Stunden später die nur 17 km entfernte Nachbarinsel Tahiti und wir machten dort an der Pier von Papeete fest.
Papeete ist die Hauptstadt von Französisch Polynesien.
Hier waren wir 1999 schon einmal gewesen und wussten, dass direkt in Hafennähe jeden Abend ein bunter Nachtmarkt aufgebaut wird, hauptsächlich dutzende Garküchen, in denen allerlei exotische, aber auch geläufige Gerichte zubereitet werden.
Diesen Markt gab es tatsächlich immer noch, war aber nur noch ein müder Abklatsch von damals. Ein paar Imbisswagen, um die herum die Tische und Stühle aufgestellt waren, boten alle mehr oder weniger ähnliche Speiseangebote feil. Der Markt war auch gut besucht, aber das Flair, das Gewusel, die Vielfalt, das alles war nicht mehr da.
Wir machten auch noch einen kurzen Abstecher in die City. Kurz deshalb, weil es hier am Abend nichts zu sehen gab. Kein Geschäft, kein Restaurant, keine Bar, nichts hatte offen, alles war verrammelt, auch die Schaufenster. Die Straßen waren menschenleer, denn um 17.00 Uhr ist hier Feierabend und zwar richtig und komplett- eigentlich eine gesunde Einstellung der Tahitianer.
Was uns auffiel war, dass es hier, wie wohl in jeder größeren Stadt auf der Welt, Obdachlose gibt, so auch hier im Südseeparadies.
Auf der Artania, auf dem hinteren Außendeck, fand unterdessen eine Folkloreshow statt, die wir aber wegen unseres Stadtbummels verpassten. Währendessen genossen wir auf einer Bank am Rande des Nachtmarkts noch die laue Abendluft, ehe wir die wenigen Schritte zum Schiff zurücklegten.
51.Reisetag - Donnerstag, 09.02.2017 Papeete/Französisch Polynesien
Gleich nach dem Frühstück ging es wieder von Bord, um dieses Mal Papeete am Tag zu erobern, da ja unser „nächtlicher Angriff“ gestern Abend kläglich gescheitert war. Gleich am Schiff wurden wir von einer musikalischen Gruppe empfangen, mit dem typischen Südseesound, nämlich Gitarre, Ukulele und mehrstimmigen Gesang. Die meisten Mitglieder dieser Gruppe waren nicht mehrganz jung, aber ihre Musik hatte "Schmackes".
Unser nächster Gang war zu einer Geldwechselbude, um 20 Euro in CFP-France (Franc des Colonies Françaises du Pacifique) zu tauschen, um auch gegebenenfalls auch dort bezahlen zu können, wo man keine Dollars oder Euros akzeptiert. Der an einer Tafel angeschlagene Kurs war Ok, allerdings hatten wir geflissentlich übersehen, dass pro Wechselvorgang eine Pauschale von 700 CFP-France anfällt, das sind etwa 6 Euro. Aber der Wechselbudenbesitzer will ja auch leben.
Unser nächstes Ziel war die Markthalle. Dort hatte ich 1999 bei einem Uhrmacherstand meine Uhr reparieren lassen, der Steg, an dem das Armband befestigt wird, war kaputt. Wir waren damals sehr beeindruckt, wie er in einem Chaos von Kästchen und Schubladen den passenden Steg fand und einsetzte.
Als wir dort ankamen, waren wir doch einigermaßen enttäuscht. Nicht dass ich erwartet hätte, dass der Uhrmacher noch da wäre und mich erkannt hätte. Aber die Markthalle war nicht mehr für die Einheimischen zum Einkaufen gedacht, sondern rein touristisch geprägt. Souvenirs und Schmuck und nur ganz verschämt in der Ecke ein paar Obst- und Gemüsestände und ein wenig Fisch und Fleischverkauf. Die „Handwerkerabteilung“ im 1. Stock war Boutiquen, Andenkenläden und Restaurantbetrieben gewichen.
Vor der Markthalle gab es einige Tische, an denen Frauen die hier typischen Blumenkränze flochten. Hier hatte sich gegenüber von damals nichts verändert.
Also ließen wir uns durch die Straßen von Papeete treiben und wo gestern Abend noch tote Hose war, brummte jetzt hier das Leben.
Am Nachmittag, gegen 16.30 begannen die Geschäfte mit den Vorbereitungen für den Ladenschluss um fünf Uhr. Und so beeilten wir uns, noch schnell zur Post zu kommen um Briefmarken zu kaufen, was auch gelang. Hierfür waren unsere CFP-France von unschätzbarem Nutzen.
Etliche Gebäude waren mit riesigen Graffitis verziert.
Wir liefen noch etwas auf gut Glück ein wenig weiter und gelangten so zufällig in einen wunderschönen gepflegten, am Meer gelegenen Park. Hier war auch das Kulturzentrum von Papeete beheimatet, mit Theater, Museen und Ausstellungen. Es gab Sportmöglichkeiten, Trimm-Dich-Geräte, Wiesen, schattige Pavillons zum Relaxen und alles sehr gepflegt und sauber. Und die einheimische Bevölkerung nutzte diese Fazilitäten ausgiebig. Es gab immer wieder etwas zu sehen und zu beobachten - schön war’s.
Auf dem Weg zurück zum Schiff wurde schon wieder der Nachtmarkt aufgebaut. Um 20.00 Uhr hieß es „Leinen los“ und wir legten ab. Zwei weitere Ziele in Französisch Polynesien standen ja noch auf dem Programm. Und das war gut so, schließlich hatten wir noch einige CFP-France, wenn auch nicht mehr allzu viele.
52.Reisetag - Freitag, 10.02.2017 Raiatea/Französisch Polynesien
220 Kilometer von Tahiti entfernt liegt die 194 km2 große Insel Raiatea. Sie ist wie Moorea und Tahiti vulkanischen Ursprungs und damit gebirgig.
Ausflüge haben wir keine gebucht und wir wollen uns einfach treiben lassen und sehen, was man machen könnte. Wie schon üblich, wurden wir an der Pier mit Musik und Tanz empfangen. Und die üblichen Souvenirstände waren auch schon aufgebaut.
Es gibt eine kleine Hauptstraße mit Geschäften und einem Supermarkt und auch hier wurde Musik gemacht und ich glaube, die Musiker waren richtig mit Spaß bei der Sache.
Musik, Musik und nochmals Musik
Es ist heiß und schwül, sodass die Lust nach größeren touristischen Aktivitäten sich in Grenzen hielt. Man hätte mit einem kleinen Boot zu einem benachbarten Motu übersetzen können um noch einmal zu schnorcheln, aber die klimatisierte Artanania lockte doch sehr.
Also wurde der Nachmittag an Bord verbracht und man genoss einfach von dort das Inselpanorama.
Am späten Nachmittag legten wir ab, um das nächste Ziel Bora Bora, dass nur ca. 50 Kilometer entfernt liegt, anzusteuern. Während dieser Passage passierten wir einige Inseln mit nur wenigen Metern Abstand zum Ufer, sodass wir so in den Genuss einer wunderbaren Panoramafahrt kamen. In weiterer Ferne konnte man schon den markanten 720 Meter hohen Berg Mont Otemanu von Bora Bora sehen. Als wir gegen 20.00 Uhr unseren Ankerplatz vor Bora Bora erreicht hatten, war es schon dunkel. Ein Landgang war nicht mehr möglich, da der Tenderservice erst für den nächsten Morgen eingerichtet werden sollte.
53.Reisetag - Samstag, 11.02.2017 Bora Bora/Französisch Polynesien
Ein aus England kommendes Paar und wir hatten per Internet eine Option für eine Schnorcheltour mit anschließendem polynesischem Essen auf einem einsamen Motu gebucht. Es sollte Spanferkel und Fisch aus dem Erdofen geben. Allerdings betrug die minimale Teilnehmerzahl 6 Personen und wir waren nur vier und konnten auch auf der Artania niemanden mehr für diesen Event rekrutieren. Deshalb fiel der Plan ins Wasser.
Wir tenderten also gegen 10.00 Uhr erst mal an Land, genauer nach Vaitape, dem Hauptort der Insel. Dort erwarteten uns die üblichen Souvenirstände und eine musikalische Folkloregruppe.
Es gab mehrere Anbieter, die einen Transfer zu einem im Süden der Insel gelegenen Strand durchführen wollten - Einheitspreis 5 Dollar. Das war äußerst praktisch, man brauchte nicht zu handeln und fuhr dem Nächstbesten. In einem offenen klapprigen Bus wurden wir in einer 15-minütigen Fahrt zum Strand gebracht. Am Ende des Strands befanden sich Bäume, die schön Schatten spendeten, genau da war dann unser Platz.
Das Wasser war warm und klar. Auch heute war die Hitze und Schwüle wieder enorm. So kam es zu dem Phänomen, dass man nach dem Baden vom Zustand „nass“ übergangslos in den Zustand „schweißnass“ wechselte, ohne zwischendurch auch nur ansatzweise den Zustand „trocken“ erlangt zu haben.
Die Suche nach einem Transportmittel zurück zur Tenderstation erwies sich als einfach. Kaum hatten wir die Uferstraße betreten, hupte uns ein Geländewagen mit einer resoluten Fahrerin an und fragte mit einer schrillen reibeisenartigen Stimme, ob wir zum Schiff wollten - Fahrpreis 5 Dollar - und natürlich wollten wir. Auf halber Strecke zeigte uns die Fahrerin noch kurz das „Bloody Mary’s.
Etwa fünf Kilometer von Vaitape in Richtung Süden liegt direkt an der Hauptstraße das Bloody Mary’s, eine weltweit bekannte Bar mit Restaurant, in der zahlreiche prominente Gäste verkehren. 230 Namen sind auf zwei Holztafeln am Eingang verzeichnet, u.a. Marlon Brando, Jane Fonda, Diana Ross.
Quelle:Wikipedia
Das halbe Schiff sprach seit Tagen von nichts anderem und wollte unbedingt dorthin. Da Doris und ich keine Promis sind und man uns deshalb nicht auf einer der zwei Tafeln verewigt hätte, fuhren wir einfach weiter.

Die schwarzen Perlen sind eine "Spezialität" der Südsee. Dementsprechend gibt es überall Schmuckläden. Allerdings benötigt man hierfür CFP-France im mehrstelligen Bereich.
Rund um die Tenderpier konnten wir unsere letzten 500 CFP-France verprassen - für 5 Bananen und 4 Ansichtskarten.
In Tahiti hatte unser Küchenchef einige große exotische Fische gekauft, die am späten Nachmittag im Foyer des Schiffes eindrucksvoll präsentiert wurden, ein Fest für die Fotografen, eine Herausforderung für die Nase.
Als die Artania den Ankerplatz von Bora Bora verließ und Kurs auf die Cook Islands nahm, standen wir noch lange an der Reling.
54.Reisetag - Sonntag, 12.02.2017 Seetag
Heute war ein Seetag ohne besondere Ereignisse, keine Gala, kein Frühschoppen, lediglich „Waffelbacken und Eiscreme“ am Nachmittag. Ich nutzte den freien Tag, um meinen Rückstand im Blogschreiben aufzuholen.
55.Reisetag - Montag, 13.02.2017 Aitutaki/Cook Islands
Um 7.00Uhr fiel der Anker vor dem Aitutaki-Atoll. Die Einfahrt in die Lagune ist zu schmal und zu seicht für die Artania, deshalb ankerten wir außerhalb. Aitutaki gehört zu den Cookinseln und ist laut Reiseführer eine der schönsten Südseeinseln. Die Cookinseln sind politisch ein selbstverwaltetes Territorium in freier Assoziierung mit Neuseeland.

Aus der Entfernung sah die Tendersituation gar nicht so dramtisch aus, aber die Strömung und Brandung hätte die Durchfahrt durch die enge Einfahrt zu einem unkalkulierbaren Wagnis gemacht.
Dass wir heute aber nicht an Land kommen sollten, war uns schon vor der entsprechenden offiziellen Verlautbarung klar.
Normalerweise erfolgt um halb acht die erste Durchsage durch den Vize-Kreuzfahrtdirektor Jörn Hofer, dass wir vor Anker liegen und ab wann mit dem ersten Tendern gerechnet werden kann. Diese Durchsage kam diesmal nicht, sondern ich wurde wie an Seetagen durch den Wecker beim Schlafen gestört. So war es auch schon bei der Osterinsel und Pitcairn gewesen.
Um viertel vor acht kam Doris von ihrem ersten Deckrundung zurück in die Kabine (sie steht lange vor mir auf) und berichtete, dass das erste Tenderboot, das noch ohne Passagiere als Scout fungiert, um die Lage an Land zu erkunden, an der schmalen Einfahrt in die Lagune gescheitert war, weil die Strömungen zu stark waren.
Kurz vor acht kam dann die Durchsage vom Kreuzfahrtdirektor höchstpersönlich, dass leider usw. ….
Also Anker wieder hoch und mit Volldampf zum nächsten Ziel, die Insel Rarotonga, die ebenfalls zu den Cookinseln gehört. Um 16.00 Uhr sollten wir dort sein.
Plötzlich war genügend Zeit, um zu versuchen, den 7. Blogeintrag online zu stellen. Im Blog-Beitrag vom 24.1.2017 (6. Blogeintrag) lobte ich noch die ausreichende Geschwindigkeit der Internetverbindung auf dem Schiff, das muss ich für heute revidieren. Nur im Zeitlupentempo trödelten die Bits und Bytes durch das Netz und es dauerte 2 Stunden, bis das letzte Bild und die letzten Texte, alles zusammen schlappe 25 MB, endlich online waren.
Am Nachmittag erfuhr ich zufällig während der nachmittäglichen Kaffeestunde, dass jeder andere Kapitän im Aitutaki-Atoll getendert hätte, nur unser bordeigenes Weichei nicht. Die Expertenrunde, die dieses nautische Statement zum Besten gab, wurde bereits von Udo Jürgens in seinem Hit „Aber bitte mit Sahne“ genauestens beschrieben. Besagte Damen beschlossen auch, künftig nur noch auf einem Phoenix-Schiff zu fahren, wenn man ihnen garantiert, dass ein ihnen genehmer Kapitän es steuern wird. Vielleicht wäre ihnen ein Kapitän Francesco Schettino lieber gewesen (Er hatte am 13.1.2013 die Costa Concordia aus Leichtsinn auf Grund gesetzt. Es gab 32 Todesopfer)

Morgen ist Valenentinstag. An der Herzform der Deko muss allerdings noch ein wenig gearbeitet werden.
Gegen 16.00 Uhr erreichten wir Rarotonga und gegen 17.00 wurde mit den Tendern an Land begonnen. Da wir aber wegen der längeren Wartezeiten für einen Platz in einem der ersten Tender erst viel später an Land gekommen wären und der letzte Tender bereits um 19.30 Uhr (kurz vorm Dunkelwerden) zurückfahren sollte, verzichteten wir auf den Landgang. Dafür war auch noch morgen genügend Zeit sein.
Auch für den heutigen Ausfall eines Reiseziels gab es wieder ein Trostpflästerchen. Phoenix war es gelungen kurzfristig für den heutigen eine Folkloregruppe aus Rarotonga zu engagieren.
56.Reisetag - Dienstag, 14.02.2017 Rarotonga/Cook Islands
Um 7.15 Uhr für bereits der erste Tender wieder an Land, aber da standen wir gerade erst auf. Um halb zehn ging es dann los. Die Idee zu eventuell zu baden hatten wir gestrichen. Es hatte die ganze Nacht geregnet und der Himmel war immer noch total bewölkt mit dunklen drohenden Wolken.
An der Tenderpier werden Tickets für verschiede Transfer und Tourangebote verkauft. Wir entscheiden uns für eine Inselrundfahrt. Unser Transportmittel ist ein Minibus und wie bekommen die letzten freie Plätze - vorne beim Fahrer, also die besten Plätze. Soviel Glück haben wir eigentlich selten, weil die besten Plätze, egal wo, schon immer besetzt sind, wenn wir kommen.
Die Tour kostete 10 Neuseeland-Dollar (Newsealand Dollar - NZD) oder 10 Euro oder 10 US-Dollar. Man operierte hier nämlich mit einem sehr einfach gestalteten Wechselkurssystem. Da wir uns zu Hause schon mit NZD eingedeckt hatten, zahlten wir auch damit. 10 NZD sind nämlich nur 6,50 €.
Die Ringstraße um die Insel ist 36 Kilometer lang, die wir in knapp 2 Stunden mit einigen Fotostopps zurücklegten. Die Insel besteht in der Hauptsache aus Bergen und nur der Schmale Küstenbereich von vielleicht einem Kilometer breite ist bewohnt.
Es gab nichts Spektakuläres zu sehen, aber trotzdem hat es uns hier am besten gefallen, hier war alles irgendwie stimmig. Die eingeschossigen Häuser sind einfach, aber sehr gepflegt, es ist sauber, die Natur und die Vegetation sind schön, typisch tropisch eben. Hier könnte man getrost Urlaub machen, die entsprechende Infrastruktur ist da, aber nicht aufdringlich und kein Massentourismus. Hier mal eine Karaoke-Bar, ein Restaurant, dort ein Anbieter für Bootsfahrten. Man könnte sich einen Motorroller mieten, um beweglich zu sein und sich eine Bucht zum Schwimmen suchen. Hier ist es einfach unaufdringlich schön. Aber der lange Flug dorthin wird uns wohl vor einem Urlaub dort abhalten

Hühnerställe gibt es hier nicht. Überall sah man die freilaufenden Hühner. Die Eier schmecken bestimmt sehr gut.
Um 14.00 Uhr legten wir schon wieder ab. Bis zur Nordinsel Neuseelands werden wir vier Tage unterwegs sein.

... als auch an Bord. Hier hatte man auch mittlerweile die Herzform mit den Ballons ganz gut hinbekommen.
57.Reisetag - Mittwoch, 15.02.2017 Seetag
Keine besonderen Vorkommnisse!
Am Abend fand die Gästeshow statt. Bei jeder Etappe melden sich immer einige freiwillige Passagiere, die etwas zum Besten geben können oder wollen. Diesmal musste man sich ob der Auftritte nicht fremdschämen. Es gab schon Nummern, die gingen etwas plump und wenig lustig unter die Gürtellinie oder die Gesangsdarbietung ließ die Mich sauer werden.
Diesmal war aber alles soweit OK. Die Solo-Gesangsnummern, der Auftritt des Artania-Chors, der sich auf jeder Reise neu formiert und die Damen der Hula- Tamouré-Tanzformation, die sich bei den Landgängen das nötige Outfit in Form von Blumenketten, bunten Tüchern etc. besorgt hatten bekamen zu recht den verdienten Applaus. Einige heitere bis besinnlichen Gedichtchen und ein paar Sketche, mal mehr und mal weniger lustig rundete das Programm ab, dessen Moderation ebenfalls von zwei Passagieren übernommen wurde.
58.Reisetag - Donnerstag, 16.02.2017 Seetag
An Seetagen hat der Fotoshop ganztätig geöffnet und die Geschäfte scheinen ganz gut zu laufen. Die Fotografen des Fotoshops fotografieren die Passagiere in allen Lebenslagen, an der Gangway beim Landgang, bei den Ausflügen, in den Restaurants bei den Galaabenden, bei den Schiffsevents wie Frühschoppen, Ablegeparty, Tanz unterm Sternenhimmel usw. So werden pro Tag geschätzte 400 -800 Fotos geschossen und gleich davon Papierabzüge gemacht. Diese werden auf mehreren großen Fotowänden präsentiert
Im Zeitalter der Digitalfotografie dürfte dieses Geschäft gar nicht mehr funktionieren, aber es funktioniert. Das hat meines Erachtens 3 Gründe:
1) Die Fotos befinden sich auf den Fotowänden nicht hinter Glas, sondern man kann sie in die Hand nehmen und sich genau betrachten. Und dadurch wächst auch die Begehrlichkeit, das Foto zu besitzen.
2a) Jeder der selbst fotografiert ist seltener selbst auf den eigenen Bildern abgelichtet und freut sich, auch einmal auf einem Foto drauf zu sein.
2b) bei Paaren gibt meist nur es wenige selbstaufgenommene Fotos, auf denen beide gleichzeitig zu sehen sind. Diesen Mangel beseitigen die Schiffsfotografen.
3) In die Fotos werden digital Beschriftungen, Grafiken, Landkarten und Sehenswürdigen eingeblendet, sodass sie mehr einer Postkarte ähneln und man sofort sieht wo bzw. zu welchem Anlass die Aufnahme entstanden ist. So unterscheiden sie sich markant von den selbstgemachten Bildern.
Außerdem kann noch Schlüsselanhänger und Magnete mit dem eigenen Konterfei erwerben.
Ein Foto kostet 6 Euro. Manchmal gibt es Sonderangebote, „Nimm 3 und bezahle nur 2“.
Auch wir haben schon das ein oder andere Foto gekauft, wenn wir gut getroffen waren. Dabei zog bei uns das Argument Nummer 2. Das zusätzlich eingeblendete Gedöns wiederum (Punkt 3) finden wir nicht so doll, nehmen es aber in Kauf.
Aber die meisten Bilder von uns sind Ladenhüter und landen zusammen mit tausenden anderen Papierbildern im Müll.
59.Reisetag - Freitag, 17.02.2017 Datumsgrenze - Tag entfällt
Das Phänomen, dass wegen Passierens der Datumsgrenze ein Bord entfällt habe ich schon einmal im Blog von 2013 lang und breit erklärt. Diejenigen, die das mal gelesen haben, rollen heute noch mit den Augen, wenn man noch einmal auf dieses Thema zu sprechen kommt. Trotzdem hier noch einmal der Link dorthin: Erläuterungen zur Datumsgrenze (2013)
Aber hier versuche ich mich jetzt kürzer zu fassen, also …:
Bei einer Fahrt Richtung Westen wird die Uhr beim Passieren eines jeden 15. Längengrads (Meridian) um eine Stunde zurückgestellt. Dass dies sinnvoll und richtig ist stelle ich mir immer so vor:
Man hat sich auf der Westfahrt ja dann um 15 Längenrade von der im Osten aufgehenden Sonne entfernt und deshalb geht die Sonne an der nun aktuellen Schiffsposition jetzt erst Stunde später auf. Und damit sich der Sonnenaufgang nicht irgendwann auf der Weiterfahrt nach Westen auf den späten Nachmittag verschiebt, stellt man die Schiffsuhr alle 15 Längengrade um eine Stunde zurück. Wenn man dann einmal um die Welt gefahren ist, hat man die Uhr 24 mal um eine Stunde zurückgestellt, denn 360 Grad geteilt durch 15 Grad ergibt genau 24 und wie jedem bekannt, besteht ein Tag genau aus 24 Stunden.
Wenn es keine Datumsgrenze gäbe, wäre nach einer Weltumrundung die Uhrzeit auf dem Schiff und am Start/Zielort zwar wieder gleich, aber der Schiffskalender würde genau um einen Tag hinterherhinken, denn es gab ja auf dem Schiff 24 Tage die eine jeweils Stunde länger als normal gedauert haben (nämlich 25 Stunden) und so hat man am Abreiskalender auf dem Schiff ein Blatt weniger abgerissen als am Start/Zielort.
Reißt man aber genau einmal irgendwann auf der Reise auf dem Schiff an einem Tag zwei anstatt nur ein Kalenderblatt ab, stimmen bei der Ankunft Schiffsuhr und Schiffskalender mit den Uhren und Kalender am Start/Zielort überein.
Jetzt hat man einfach international festgelegt, dass die sogenannte Datumsgrenze beim 180. Längengrad verläuft, als genau in der Hälfte einer Erdumrundung, vom 0. Längengrad (Greenwich) aus betrachtet.
Wenn man auf dem Schiff immer um genau 24 Uhr das Kalenderblatt abreißt und dann zufällig den 180. Längengrad genau um 24. Uhr passiert, muss man in diesem Fall 2 Kalenderblätter abreißen, sodass plötzlich ein ganzer Tag entfällt.
In der Regel überfährt man die Datumsgrenze aber nicht genau24 Uhr. Stellen wir als das foldende Szenario vor. Die Artania überfährt die Datumsgrenze am 16. Februar 2017 um 11.00 Uhr vormittags. Dadurch „springt“ auf dem Schiff das Datum auf den 17.Februar 2017 und es ist immer noch 11.00 Uhr vormittags. Das heißt auf dem Schiff hat der 16.2 nur 11 Stunden und der 17.2. nur 13 Stunden. Der Es entfällt kein Tag, aber beide Tage sind kürzer und ergeben in der Summe 24 Stunden.
Aber der Einfachheit wegen „tat man so“, als hätte man die Datumsgrenze am 16.2 genau um 24 Uhr passiert, sodass man die beiden Kalenderblätter 16.2 und 17.2 gleichzeitig abreisen musste und man so übergangslos im 18. Februar gelandet ist.
Der Übergang genau um 24 Uhr wurde auf dem Schiff ein bisschen wie Silvester gefeiert. Die Sekunden bis Mitternacht wurden heruntergezählt und man konnte dann über einen auf Deck gezogenen Strich hüpfen, um so den Datumssprung zu vollziehen und erhielt für diese sportliche Leistung gratis einen Wodka
Jetzt müsste man genaugenommen bei meinem Gedankenmodell eigentlich noch berücksichtigen, dass mit dem Überschreiten der Datumsgrenze gleichzeitig auch noch eine neue Zeitzone beginnt, also die Uhr um eine Stunde zurückgestellt wird. Wenn man in die Überlegungen auch noch die Wechsel von Winter und Sommerzeit einbezieht, wird es vollkommen gaga.
Eigentlich genügt es zu wissen, dass wir bis zum Passieren der Datumsgrenze durch das Zurückstellen der Uhren 12 Stunden „gewonnen“ haben. Durch den „Verlust“ eines Tages, also dem Minus von 24 Stunden, können wir einen derzeitigen „Gesamtverlust“ von 12 Stunden (+12 - 24) bilanzieren. Bis wir in Venedig ankommen werden, werden wir noch 12-mal die Uhren um eine Stunde zurückgestellt und somit den derzeitigen Verlust wieder ausgeglichen haben. Somit kommen mit +/- Null aus der Nummer heraus.
Naja, so ganz kurz sind meine Erklärungen zur Datumsgrenze wieder nicht ausgefallen - sorry.
60.Reisetag - Samstag, 18.02.2017 Seetag
Der Datumssprung hat noch die ein oder andere kleine Nachwirkung etwa in Form von Kalauern derart: „Gestern hat es überhaupt nichts zu essen gegeben“.
Diesem virtuellen Fastentag glich das Schiff dahingegen aus, dass, wie auf jeder Etappe der Reise, ein Frühschoppen mit Freibier, Spanferkel und Weißwurst veranstaltet wurde. Zwar nennt sich diese Veranstaltung nicht mehr wie vor zwei Jahren noch „Bayerischer Frühschoppen“, sondern es wird jetzt ein „Stadl Frühschoppen“ zelebriert. Od dieser neue Name etwas mit „political correctness“ zu tun hat kann ich nicht sagen Auf alle Fälle ist die Kostümierung der Kellner immer noch die Gleiche und auch die Phoenix-Leute sind nach wie vor bajuwarisch gewandet.
Am Nachmittag wurde zum Abschieds-Cocktail eingeladen und für den Abend war die Abschiedsgala angesagt. In drei Tagen ist wieder eine Etappe zu Ende.
61. Reisetag - Sonntag, 19.02.2017 Tauranga/Neuseeland
Heute war zunächst einmal ein ganz normaler Seetag, zumindest bis 20.00 Uhr. Normaler „Schiffsalltag“ am Vormittag. Der Nachmittag hatte dann etwas mehr zu bieten. Wir passirrten die Insel White Island in der Bay of Plenty. White Island oder Whakaari wie die Insel in der Sprache der Māori, den Ureinwohner Polynesiens, heißt, ist die einzige aktive Vulkaninsel Neuseelands. Aus dem Erdinneren steigen Rauchschwaden und schweflige Dämpfe auf, was das Herz der Fotografen an Bord höher schlagen ließ. Die Insel ist unbewohnt. Früher wurde hier einmal der Schwefel abgebaut. Heute treibt es nur noch Vulkanologen und angeblich auch Tagestouristen auf die Insel. Auch Phoenix bot einen Helikopterausflug von unserem heutigen und Zielhafen Tauranga auf die Insel an (750 €). Wir erreichten die Insel gegen 15.00 Uhr und der Kapitän ließ es sich nicht nehmen, uns eine Runde um die Insel zu spendieren. Die anfängliche Enge ob der vielen „Vulkanologen“ an den Relings auf den Außendecks ebbte gegen 15.30 merklich ab, denn da begann im Restaurant „Vier Jahreszeiten“ auf Deck 2 die Kaffeestunde.
Gegen 20.00 Uhr erreichten wir den Hafen von Tauranga/Neuseeland, d.h. eigentlich nicht direkt dort, sondern im Vorort Mount Maunganui. Der Ort heißt so, wie der gleichnamige Berg, ein erloschener Vulkan. Er ist zwar nur 230 Meter hoch, sein Anblick beherrscht aber das gesamte flache Umland. Ein wirklich schönes Bild in der Abendsonne, der uns während des Einlaufens geboten wurde.
Nach dem langen Törn durch die Südsee hatten wir die Nordinsel Neuseelands erreicht.
Nach mehr als 4 Tagen auf See, war der Landgang unumgänglich, obwohl es mittlerweile schon dunkel geworden war. Eine Jacke war mittlerweile am Abend auch wieder von Nöten, denn wir hatten mit Überschreiten des südlichen Wendekreises schon vor drei Tagen die tropische Zone verlassen.
In der Nähe des Hafens befand sich eine Bushaltestelle und ich wunderte mich warum dort so viele Leute vom Schiff dort auf den Bus warteten. Wir waren informiert worden, dass die Linie 1 und 2 für wenig Geld in das 7 Kilometer entfernte Zentrum von Tauranga fahren würde. Aber das so viele die Fahrt am Abend noch antreten wollten?
Des Rätsels Lösung wurde mir schnell vor Augen geführt, als ich neben der Haltestelle das Schild „Free WiFi Zone“ entdeckte.

Sehr viele Menschen hier sind reich und großflächig tätowiert, in der Regel mit klassischen Motiven, wie sie seit Jahrhunderten von und bei den Māori gestochen werden. Bei dieser jungen Dame sind allerdings neuzeitlichere Tatoo-Motive zu bewundern. .
Ein paar Meter weiter brodelte schon das „Nachtleben“. Auf der Hauptgeschäftsstraße gab es eine Reihe uriger Kneipen. In einer davon endeckten wir einige Bekannte, zu denen wir uns gesellten und gemütlich ein Bier tranken.
62.Reisetag - Montag, 20.02.2017 Tauranga/Neuseeland
Gleich nach dem Frühstück zogen wir los, um den Ort bei Tageslicht zu erkunden. Allerdings stand zunächst ein Friseurbesuch. Gleich am Hafenausgang, noch vor der Bushaltestelle mit WiFi, stand ein wahnwitziges Motorrad mit Platz für 5 Personen. Der Besitzer von diesem Gefährt, der damit Touren anbietet, konnte und in Sachen Friseur weiterhelfen, indem er uns den Weg dorthin beschrieb.
Dort angekommen, stellten wir fest, dass der Laden montags geschlossen hat - logisch, montags haben die Friseure weltweit ihren freien Tag. Zum Glück endeckten wir noch eine Friseurin, die sich nicht an die globale Regelung der Innung gehalten hatte.
Aber jetzt stand unserer Erkundung nichts mehr im Weg. Wir stellten fest, dass die Menschen hier äußerst locker, offen und freundlich sind, Straßen, Häuser und Parks absolut sauber und gepflegt sind und die Preise für alles exorbitant hoch sind.
Auch in Sachen Ordnungsgeld ist man hier nicht kleinlich. Wenn die Hinterlassenschaft von Fifi auf einer öffentlichen Wiese nicht im Beutelchen wieder mitgenommen wird oder Waldi trotz eines Verbotsschild einen Kinderspielplatz betritt, kostet das 300 New Zealand Dollars (NZD), das sind ca. 250 Euro.
Der Höhepunkt des Tages fand am Nachmittag statt - ein Hubschrauberrundflug. Wir waren neun Leute, die diesen Flug gebucht hatten und wurden vom Veranstalter in einem Minibus abgeholt. Am Flugplatz wurden wir in drei Gruppen aufgeteilt, da der kleine rote Hubschrauber Platz für vier Personen hatte und der Pilot auch unbedingt mitfliegen wollte.
Unsere Gruppe bestand aus Doris, mir und einem weiteren älteren Herren. Eine Dame von der Rundflug-Firma fragte unsere Gruppe, wer denn gerne vorne sitzen möchte und Doris war die reaktionsschnellste beim „Hier“ rufen.

Keine Angst, das sieht nur so aus, als ob Doris den Hubschrauber fliegen würde. Aber in Neuseeland herrscht auf der Straße Linksverkehr, deshalb ist sowohl bei Autos als auch bei Hubschraubern das Steuerrad auf der rechten Seite.
Beim Einsteigen hätte sie ihren Logenplatz beinahe wieder eingebüßt, weil unser Fluggefährte versuchte vorn neben dem Piloten Platz u nehmen, aber Doris bekam von der Rundflug-Dame Schützenhilfe. Nachdem alle ihre Plätze eingenommen hatten, ging es los. Flug um den „Hausberg“ Maunganui, dann über die Bucht und über den Ort wieder zurück zu dem leinen Sportfliugplatz, von wo wir gestartet waren. Das Vergnügen war zwar nur sehr kurz, nämlich geringfügig mehr als 10 Minuten, aber jeden Euro wert.
Nachdem wir wieder zum Schiff zurückgebracht worden waren, trabten wir noch einmal in das Städtchen und bestiegen den Hügel „Mont Drury“ (Aufstiegszeit 5 Minuten) und hatten noch einmal einen schönen Rundblick.

Ein netter Kiwi (so bezeichnen sich die Neuseelaänder auch selbst) hat auf dem Mont Drury dieses Foto von uns gemacht

Auf dem Rückweg zum Schiff begegnete uns noch dieser Mini-Cooper, der zur Strech-Limousine umgebaut worden ist. An die Schnapsbar und Halter für die Schampus-Flasche hatte der Konstrukteur ebenfalls gedacht.
Am Abend, wir hatten schon Kurs Richtung Auckland genommen, fand im Foyer der Artania noch eine Ausstellung von Eisskulpturen statt. Fast jedes Kreuzfahrtschiff leistet sich einen philippinischen Eiskünstler, der wie ein Bildhauer aus einem großen Eisblock Figuren herausmeiselt. Allerdings ist das Figurenschnitzen kein Fulltimejob, sodass die Künstler in der Hauptsache meist in der Küche oder im Service arbeiten.
63. Reisetag - Dienstag, 21.02.2017 Auckland/Neuseeland
Ganz früh am Morgen hatte die Artania in Auckland festgemacht. Wir werden hier jetzt drei Tage liegen bleiben.
Gleich nach dem Frühstück ging es raus. Der Hafen liegt sehr zentral, hier beginnt gleich das Zentrum von Auckland. Hochhäuser von Banken, Versicherungen und alle wichtigen große Unternehmen haben hier ihre Hochhäuser und prägen das Stadtbild. Hier beginnt auch die Queen Street, die Geschäftsstraße von Auckland. Die wanderten wir einmal hoch und runter, können aber nicht sagen, dass es für uns besonders interessant war. Wir habe auch weder bei Prada noch Gucci irgendetwas gekauft. Halt doch, am oberen Ende kurz vor dem Aotea Centre, kaufte sich Doris einen Donat und musste feststellen, dass das der Beste Donat war, den sie je genossen hätte. So gesehen hat sich Auckland schon gelohnt.
Aber neben dem Donat gab es noch ein weiteres Highlight, der Sky Tower. Ein Fernsehturm, der mit 328 Meter Höhe, das höchste Gebäude auf der südlichen Erdhalbkugel, wie im Reiseführer zu lesen ist. Die Hauptaufgabe des Turms scheint aber nicht das Senden von Fernseh- und Funksignalen, sondern zum Anlocken von Touristen zu sein. Der Zutritt ist nur über den Giftshop (Souvenirladen) im Basement eines benachbarten Hotels möglich. Zwei Aussichtplattformen und ein Café sind für die „normalen“ Touristen angedacht, die Möglichkeit eines Skywalks (145 NZD = 95 €) oder eines Skyjumps (225 NZD = 147 €), das ist eine Art Bungee-Light-Sprungs aus luftiger Höhe, ist mehr das Angebot an die Adrenalin-Freaks.
Skywalk bedeutet, auf einem Gitterrost, welches in 300 Meter Höhe um den Turm führt, zu laufen, gesichert mit einem Drahtseil. Während des Walks sind etliche „Challanges“ zu absolvieren, so zum Beispiel, sich so über den Rand des Gitterrosts zu beugen, bis das Sicherungsseil gestrafft ist.
Der Skyjump ist ein Sprung vom Turm, aber nicht an einem Gummiseil, sondern an einem Drahtseil hängend, das denn Fall während des Flugs schon etwas bremst und am Ende der „Fahrt“ den Fall sanft abfedert.
Bis auf Skywalk und Bungeesprung haben wir sonst fast alle Möglichkeiten des Turms genutzt. Das, das Foto allerdings, das der Turmfotograf von uns gemacht hat, und uns später zusammen mit einer bunten Mappe für 40 NZD (mehr als 25 €) verkaufen wollte, ging nicht in unseren Besitz über.
64. Reisetag - Mittwoch, 22.02.2017 Auckland/Neuseeland
Wenn in Neuseeland von Kiwis die Rede ist, können drei Dinge gemeint sein:
- Die Frucht mit der pelzigen Schale
- Der Vogel mit dem spitzen Schnabel
- Der Neuseeländer selbst
Wir interessierten uns ganz besonders für die Variante Nummer zwei. Denn wenn man durch die Geschäfte stromert, gewinngt man den Eindruck, dass die Kiwi-Vögel beinahe eine Landplage sein müssten. Als Plüschtniere in jedweder Größe und Form, abgebildet auf Magneten, auf Tassen, Postern und Postkarten, auf Stickern und Tassen - Kiwis soweit das Auge reicht.
Die Realität sieht leider anders aus. Die Kiwis sind eine bedrohte Tierart. Und da sie außschließlich nachtaktiv sind, hat der normale Tourist überhaupt keine Chance, diese Vögel in der freien Natur zu beobachten.
Deswegen stand für heute ein Besuch der hiesigen Zoos auf dem Programm.
Vorher aber galt es Abschied nehmen, denn heute ging die Etappe „Südseeträume“ zu Ende und 5 junge Passagiere, mit denen wir uns angefreundet hatten, gingen von Bord. Es war erfrischend mit diesem Trüppchen zusammen gewesen zu sein. Einer von ihnen, Volker, hatte gestern den Skywalk gewagt und konnte uns noch auf die Schnelle aufregende Fotos zeigen. Von Katharina „erbten“ wir noch 4 Kleiderbügel und durch die Übernahme von Sekt, Cidre und Oliven von Chris verhinderten wir, dass er beim Heimflug für Übergepäck bezahlen musste.
Es ist mehr als Schade, dass sie nun nicht mehr an Bord sind.
Aber wie sagte schon der bekannte Philosoph und ehemalige Trainer der Eintracht Frankfurt Dragoslav „Stepi“ Stepanović? „Lebbe geht weidder“ (Das Leben geht weiter).
Die einfachste Möglichkeit in den etwas außerhalb liegenden Zoo gelangen, sahen wir in der Nutzung des Hop-on-Hop-Off-Busses. Gesagt getan, für umgerechnet je 25 EUR kauften wir uns ein Ticket kamen aber in den Bus nicht rein, denn er war schon voll. Und die Schlange der bereits Wartenden, ließ vermuten, dass wir auch in den Nächsten, der 30 Minuten später fahren sollte, auch nicht rein kämen.
So wendeten wir den folgenden Trick an: Wir gingen zu Fuß zur vorhergehenden Haltestelle, die sich am Sky Tower befand, wo wir nach gut 20 Minuten ankamen und dort einen fast leeren Bus besteigen konnten. Als wir ein paar Minuten später dann wieder an der ursprünglichen Haltestelle am Hafen ankamen, war dort seltsamerweise gar keine Warteschlange mehr. Wahrscheinlich wurde vorher noch ein zusätzlicher Bus eingesetzt.
Da vor der Zoo-Haltestelle noch die Station „Parnell Rose Gardens“ lag, legten wir dort einen Zwischenstopp ein und besichtigten die schön angelegten Rosengärten und einen Naturpark. Leider war die hohe Zeit der Rosen schon vorbei.

Warnwesten wohin man sieht, hier der Gärtner vom Park. Selbst der Prospektverteiler an der Pier trug eine.
Der Auckland-Zoo legt großen Wert darauf, die Tiere möglichst artgerecht zu halten. Dadurch war es nicht immer leicht, die Tiere in den Gehegen zu sehen, da man für sie Rückzugsmöglichkeiten geschaffen hatte.
Am eindrucksvollsten waren wohl die Galápagos-Riesenschildkröten, zumal sie leichter zu beobachten waren als die Kiwis im völlig abgedunkelten Kiwi-Haus hinter den großen Glasscheiben. Hinter den Scheiben befand sich ein kleines angelegtes Wäldchen, das nur durch einen künstlichen ganz schwach strahlenden Mond beleuchtet wurde. Es dauerte lange bis sich die Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Dennoch waren immer noch keine Kiwis zu sehen, weil diese sich versteckt hatten. Irgendwann konnten wir schließlich ein Exemplar, etwa so groß wie ein ausgewachsenes Huhn, entdecken, nachdem uns ein Tierpfleger darauf aufmerksam gemacht hatte. Fotografieren war verständlicher Weise nicht möglich.
Mit dem vorletzten Hop-On-Bus fuhren wir um 16 Uhr zum Hafen zurück und tranken an der Waterfront noch gemütlich einen Kaffee.
Am Abend konnte man, wie schon gestern, das Zurückkommen der vielen Katamaran-Personenfähren, die hier eingesetzt werden, beobachten. Es herrschte hier tagsüber ein reger Verkehr wie am ZOB (Zentraler Omnibusbahnhof) in einer deutschen Großstadt.
Die nächste Etappe der Reise (mittlerweile die vierte) wurde eingeläutet, der Passagierwechsel war weitgehend vollzogen und das Motto des neuen Reiseabschnitts lautete: “Neuseealands schönste Seiten“. Aber „Leinen los“ wird es erst morgen Abend heißen, damit die Neuankömmlinge noch etwas von Auckland haben.
65. Reisetag - Donnerstag, 23.02.2017 Auckland/Neuseeland
Nach zwei Tagen „Auckland intensiv“ konnten wir es heute etwas lockerer angehen. Doris streifte etwas durch die Hafengegen und ich verbrachte den Vormittag in meinem „Büro“ um den Rückstand beim Schreiben etwas zu verkürzen.

Alle Leute wollten aufs Oberdeck. Hier Achtern waren wir windgeschützt, hatte eine freie Reling und Platz ohne Ende
Aber gleich nach dem Mittagessen gingen wir los. Da man nach zwei Tagen an Land doch gewisse Entzugserscheinungen bezüglich Schifffahren bemerkbar machten, hatte Doris am Vormittag absprachegemäß zwei Tickets für eine Hafenrundfahrt gekauft, die wir nun antraten. Zu berichten gibt es darüber fast nichts. Nach 90 Minuten war dieser „gekaufte Seetag“ wieder zu Ende.

Während der Hafenrundfahrt hatte man einen schönen Blick auf die Skyline. Im Vordergrund sieht man die Artania und einige der unermütlichen kleinen Fährschiffe
In den letzten zwei Tagen wurden wir mehrmals intensiv von der Reiseleitung darüber aufgeklärt, dass die Mitnahme von Lebensmitteln jeglicher Art an Land strengstens verboten sei. Neuseeland will sich insbesondere dagegen schützen, dass unkontrolliert neue Pflanzen (durch Samen in Obst) eingeführt werden. Das wurde im Hafengebäude auch kontrolliert, teilweise mit einem Hund, der an jeder Tasche und jedem Rucksack schnüffelte. Es wurden wohl auch einige Passagiere erwischt, die, sei es versehentlich oder bewusst, Obst in Ihren Taschen hatten.
Doris und ich befolgten selbstverständlich solche Verbote .
Trotz unseres Gehorsams gegenüber Behörden fielen wir bei der heutigen Rückkehr zum Schiff "unangenehm" auf.
Im Hafengebäude wurden wir, nachdem wir wie immer unsere Bordausweise gezeigt hatten, gefragt, ob wir spitze, scharfe oder gefährliche Gegenstände mitführen würden. Dies hatte zwei Tage lang keinen einzigen Kiwi hier irgendwie interessiert, noch war uns bewusst, dass dies ein Problem darstellen könnte und außerdem hatten wir solche Dinge sowieso nicht mit, was wir dem Security-Mann auch so sagten. Bis mir plötzlich einfiel, dass ich ja mein Schweizer Taschenmesser im Rucksack habe. Ich korrigiere meine Angabe dahingehend und gestand, nachdem ich kur überlegt hatte, ob ich mich einfach weiterhin dumm stelle..
Das Messer wurde sofort konfisziert und man erklärte mir, dass es viel zu gefährlich sei, mit so einem Gerät durch das Gebäude zu laufen.
Wenn ich es mir recht überlege, hätte ich auch die Mitführung meines Taschenkompasses melden müssen, schließlich handelt es bei der Kompassnadel um einen spitzen Gegenstand.
Aber Neuseeland wäre nicht Neuseeland, wo alles gut geregelt ist. Ich bekam eine ordentliche Quittung, man schrieb meinen Namen und die Kabinennummer auf und versprach, zwei Stunden vor dem Ablegen, würde das Corpus Delicti dem Schiff übergeben werden.
Ich weiß nicht, wer es verpennt hatte, uns Passagiere darüber zu informieren, dass es solche Problemchen mit Messern geben kann. Waren es die neuseeländischen Behörden selbst oder hätte das die Reiseleitung wissen müssen?
Wenn wir gerade beim Thema „Behördenunsinn“ sind. Gestern wurde in unserem Gang in sämtliche Kabinentüren ein Türspion eingebaut. Das war uns zunächst gar nicht aufgefallen, aber in der Nacht fiel durch die Linse im Spion ein gebündelter Lichtstrahl, denn auf dem Gang brennt die ganze Nacht das Licht. Besagter gebündelter Strahl stört allerdings den schlafenden Mitbürger. Abhilfe war schnell geschafft. Noch in der Nacht haben wir mit schwarzem Klebeband denn Spion zugeklebt (Der erfahrene Kreuzfahrer hat so etwas natürlich neben einem Multitiool, Schaumgummi, zwei Meter Kordel, Wäscheklammern im Gepäck).
Die ganze Türspion-Geschichte ist insofern Behördenblödsinn, da dies angeblich für Kreuzfahrtschiffe, die amerikanische Häfen anlaufen möchten, jetzt Vorschrift sei. Und im nächsten Jahr wird die Artania verschiedene Häfen an Amerikas Ostküste anlaufen.
Um 21.00 Uhr mussten wieder sowohl die neuen Passagiere als auch wir „Langzeitgäste“ an der obligatorischen Rettungsübung teilnehmen. Auch so eine neumodische Regelung. Noch vor zwei Jahren brauchten die Langzeitgäste diese Übung nicht alle 3 Wochen wiederholen.
Um 22.00 Uhr erklang durch die Lautsprecher die Auslaufmelodie, was uns noch einmal auf das Promenadendeck trieb, um Auckland lebewohl zu sagen.
66. Reisetag - Freitag, 24.02.2017 Bay of Islands/Neuseeland
Die Bay of Islands ist keine Stadt, sondern bezeichnet einen Küstenabschnitt im Norden der neuseeländischen Nordinsel. Wir lagen auf Reede, die Tenderpier lag zwar mitten in der „Pampa“, aber es gab einen prima von den Neuseeländern kostenlos angebotenen Shuttleservice. Kaum Wartezeiten, keine Kapazitätsengpässe, so erreichten wir das nahe gelegene Örtchen Paihia (1.700 Einw.).
Die Landschaft erinnert ein wenig an Kanada.
Eigentlich wollten wir mit der Fähre nach Russel übersetzen, weil das von der Phoenix-Reiseleitung als sehre sehenswert propagiert wurde. Da das kleine Fährboot aber bereits voll war, vertraten wir uns zunächst in Paihia die Beine. Hier gab es einen kleinen Kunsthandwerkermarkt, der uns so in Anspruch nahm, dass wir erst mit der über-übernächsten Fähre nach Russel übersetzen konnten.
Russel ist ein Urlauberörtchen mit kleinen Geschäften und Restaurants, die Gebäude meist aus Holz, was sehr hübsch aussieht.
Zum Mittagessen gab es einen kleinen Snack in einem Restaurant, um so gestärkt, das örtliche Museum anzusteuern. In der Landgangsinformation, die wir am Vorband von Phoenix erhalten hatten, war nämlich zu lesen, das man hier einen Nachbau der Endeavour zu bewundern sei. Die Endeavour war das Segelschiff mit dem Captain James Cook zwischen 1768 und 1771 seine berühmte Entdeckungsreise in die Südsee unternahm. Mich hatte besonders daran interessier, wie sie 70 Mann starke Besatzung auf einem 40 Meter langem Segelschiff gehaust haben muss.
Dummerweise hatte unsere liebe Reiseleitung die Begriffe Nachbau und Modell verwechselt. Ausgestellt war ein Schiffsmodel im Maßstab 1:5, bei dem das Schiffsinnere nicht modelliert war.
Trotzdem war ein Durchgang durch das kleine schnuckelige Museum, das einiges über die lokale Geschichte des Ortes zeigte, nicht uninteressant. Ein Abstecher in die kleine Holzkirche rundete unseren Besuch in Russel ab.
Am Abend fand eine Folkloreveranstaltung außen auf dem Achterdeck statt, vorgeführt von Māoris. Die Māori sind eine indigene polynesische Bevölkerungsgruppe, die im 13. Jahrhundert, also lange vor der Entdeckung durch die Europäer, Neuseeland besiedelte. Diese Folkoregruppe der Māori führte Tänze vor, die in ihrer Sprache Haka werden. In der Kriegstanzvariante des Hakas reißen die Tänzer die Augen auf und strecken die Zunge weit heraus, was den Gegnern Angst einflößen soll.
Der Kriegstanz Haka wird übrigens von der sehr populären Neuseeländischen Rugbymannschaft „All Blacks“, in der viele Māoris mitspielen, vor jedem ihrer Spiele zelebriert.
67. Reisetag - Samstag, 25.02.2017 Seetag
An diesem Seetag wurde am Vormittag wieder der maritime Frühschoppen veranstaltet. Ich nutzte diesen „freien Tag“ um meine Rückstände beim Reiseblogschreiben aufzuholen.
Ganz bestimmt erwähnenswert ist ganz bestimmt auch, dass ich vor 3 Tagen in der Kabine eine Flasche Wein und einen Käseteller vorfand. Eine kleine Notiz, ließ mich wissen, dass dieses Kabinenpräsent von einem Leser des Blogs stammt, der dies aus Deutschland irgendwie organisiert hat und mir damit eine Freude machen wollte und dies ist ihm außerordentlich gut gelungen.
68. Reisetag - Sonntag, 26.02.2017 New Plymouth/Neuseeland
Früh um 7.00 Uhr, also noch vor dem Aufstehen, machten wir an der Pier in Containerhafen von Taranaki fest. Taranaki ist allerdings kein Ort, sondern bezeichnet eine Region an der Westküste der Nordinsel.
Containerhäfen liegen in der Regel von abseits von touristisch interessanten Orten Deshalb ging es mit dem Shuttlebus um 10.00 Uhr in das nahe New Plymouth. Ein Becken mit Aalen an einem Restaurant und ein kleiner Kunsthandwerkermarkt waren hier neben dem WiFi vor der Bibliothek das wenige, was der Ort dem verwöhnten Kreuzfahrer zu bieten hatte.
Schon seit Beginn der neuseeländischen Häfen waren wir davon überzeugt, in keinem Shop und auf keinem Markt einen irgendwie gearteten Kiwi zu kaufen. leider boten zwei Schwestern, die den Müßiggang des Rentnerdaseins dadurch entflohen, dass sie Stoffkiwis herstellten, eben diese feil. Plötzlich waren unsere Vorsätze bezüglich Kiwiverweigerung vollkommen vergessen Jetzt haben wir in unserer Kabine einen flauschigen Reisegefährten.
Außer dem Kiwi haben wir aus New Plymouth wieder einmal den Eindruck mit zum Schiff genommen, dass die Leute hier in Neuseeland locker, überaus freundlich und offen sind. Ob an den Verkaufsständen, in den Geschäften oder einfach auf der Straße, man kommt mit den Leuten ganz zwanglos ins Gespräch.
Hier in New Plymouth sind die Leute stolz auf ihren Hausberg, den Mount Taranaki, ein 2518 Meter hoher Vulkan, der letztmalig 1854 Lava ausgestoßen hat. Die Leute bedauerten uns gegenüber immer wieder, wie schade es sei, dass man wegen der Wolken den Gipfel heute nicht sehen kann.
Am Nachmittag stand ein Besuch des Mount Taranaki per gebuchten Ausflug auf dem Programm. Mit dem Bus ging es bis auf 1000 Meter Höhe. Dort gab es ein Besucherzentrum und von dort aus führten diverse Wanderwege in die Bergregion. Unsere Ausflugsgruppe beschritt zuerst den kürzesten Pfad, ein Rundweg, den man in einer halben Stunde bewerkstelligen kann. Es war eine wunderschöne Strecke durch den Regenwald, allerdings war der Pfad sehr eng und bei 50 Leuten die mehr oder weniger im Gänsemarsch durch den Dschungel stapften, blieb das Naturerlebnis auf der Strecke.
Als dann der nächste Rundkurs (40 Minuten) in Angriff genommen wurde, meldeten wir uns bei der Reiseleitung ab und nahmen noch einmal den eben gemeisterten Weg noch einmal in Angriff, diesmal aber alleine und in umgekehrter Richtung. Jetzt konnte man stehen bleiben wo man wollte und wie lange man wollte und sah auch mal einen Vogel.
Am Besucherzentrum des Naturparks trafen wir wieder auf unsere Gruppe und als Zugabe des Wettergottes, riss die Wolkendecke auf und man konnte auch die Vulkanspitze in voller Schönheit bewundern.

Neuseeland exportiert sehr viel Pinienholz, ein schnell nachwachsendes Holz. Innerhalb von 15 Jahren ist ein Baum schlagreif. Fast in jedem Hafen stapeln sich die Stämme, so auch hier in Port Taranaki
Nach der Rückkehr vom Ausflug genossen wir noch lange an Deck die Aussicht, während die leinen losgemacht wurden und das Schiff die Bucht von Tarnaki bei strahlender Abendsonne verließ.
Und zum krönenden Abschluss gab es zum Abendessen in den Restaurants Schnitzer Wiener Art.

Auf einer Mole beobachteten viele Schaulustige das Auslaufen der Artania. Wir geniesen das Privileg, auf der Artania mitfahren zu dürfen.
69. Reisetag - Rosenmontag, 27.02.2017 Wellington/Neuseeland
Wer bisher Wellington nur als Beef von der Speisekarte kannte, es gibt noch eine zweite Möglichkeit. Hier ist die Hauptstadt von Neuseeland gemeint, die sich an der Südspitze der Nordinsel befindet.
Ein kostenloser Shuttlebus des Wellingtoner Tourist-Service brachte uns ins Zentrum der Stadt.
Unser erstes Ziel war die Talstation einer Standseilbahn ganz in der Nähe der Haltestelle des Shuttlebusses. Wir kauften uns gleich eine Rückfahrkarte, da diese 50 Cent billiger ist als jeweils ein separates Ticket für die Hin und die Rückfahrt. Nach kurzer Fahrt hatten wir die Bergstation erreicht und das angeschlossene Cable Car Museum in kurzer Zeit durchschritten.
Der Blick und die Aussicht von hier oben auf die Stadt bekam die touristische Note Drei-Minus.
Gleich um die Ecke entdeckten wir einen Park, der sich als ein großer und weitläufiger botanischer Garten entpuppte. Auch hier traf man, wie schon an der Bushaltestelle auf die sogenannten Tourist-Ambassedors (Touristen-Botschafter). Das sind freiwillige Helfer, meist Rentner, gekennzeichnet durch eine gelbe Weste mit der Aufschrift „Ask Me“ (Frage mich), die für uns Touris positioniert sind, um uns Tipps zu geben, den Weg zu zeigen oder um sonstige Fragen zu beantworten - eine super Einrichtung!
So ein Ambassador erklärte uns, welchen Weg wir durch den Garten nehmen konnten, um wieder unten im Zentrum anzukommen. Eine Karte des Parks erhielten wir zusätzlich, sodass ein Verirren wie weiland bei Hänsel und Gretel weitgehend ausgeschlossen war.
Der Weg durch den Park war teilweise durchaus mit der gestrigen kleinen Wanderung vergleichbar. Man kam durch Wälder, aber auch durch parkähnliche Teile mit Blumen und Kräutern. Viele Informationstafeln und ein Besucherzentrum (mit freiem WLAN) stillten den botanischen Wissensdurst der Besucher. In der Nähe des Ausgangs (bzw. Eingangs, wenn man direkt vom Zentrum aus den Park betritt) befand sich noch ein Rosengarten und ein riesiges Gewächshaus (mit angeschlossenem Souvenirladen), denen wir auch noch einen Besuch abstatteten. So gelangten wir wieder in das städtische Leben zurück. Vorbei am Parlamentsgebäude und der Universität waren wir bald wieder in der Nähe der Talstation der Standseilbahn.
Jetzt erst bemerkten wir den kapitalen Fehler, den wir begangen hatten. Trotz Rückfahrkarte hatten wir den Abstieg zu Fuß unternommen. Die Idee, noch einmal eine Fahrkarte nach oben zu kaufen um die Rückfahrkarte für die Talfahrt doch noch nutzen zu können, verwarfen wir genauso, wie den Versuch, die Tickets bei Ebay zu versteigern.
Nach einem kurzen Mittagsmahl bei Burger King gingen wir die nächste Wellingtoner Attraktion an, die Cuba Street. Laut Reiseführer die coolste Straße in ganz Neuseeland. Trotz bereits angehenden leichten Fußwehs machten wir uns auf den nicht ganz so kurzen Weg dorthin.
Na ja, coolste Straße? Es gab ein paar urige Cafés und Kneipen, Schallplatten (Vinyl!) und Klamottenläden. Nach 50% durchkämmter Cuba Street legte Doris eine Kaffeepause ein, während ich mich alleine weiter auf der Suche nach der ultimativen Coolheit machte, leider ohne großen Erfolg.
Schöner und Interessanter war dann hingegen der kleine Streifzug durch die Gegend am Wasser.
Viel zu schnell wurde es Zeit (17.30 Uhr), der Waterfront den Rücken zu kehren, um mit dem Shuttle zum Schiff zurückzukehren.

Wassersport wird in Neuseeland ganz groß geschrieben. Auf unserem Spaziergang an der Waterfront trafen wir auf diese Mädels, die gerade eine Trainingseinheit absolvierten.
Am späteren Abend wurde an der Phoenix Bar am hinteren Außendeck noch schnell der Rosenmontag zelebriert.
Der schiffeigene DJ sorgte für die Stimmungsmusik, ein Tanzmariechen schwang gekonnt die Beine und auch eine kleine Büttenrede wurde zum Besten gegeben. Schunkeln und Polonäse fehlten ebenso wenig wie die reichlich angebotenen Kreppel (Berliner, Krapfen). Somit hatte das (Narren)-Schiff seine karnevalistische Pflicht erfüllt.
70. Reisetag - Dienstag, 28.02.2017 Lyttleton/Neuseeland
In der Nacht verließen wir die Nordinsel und erreichten am Morgen die Region Canterbury auf der Südinsel und dort den Containerhafen Lyttleton.
Waren unsere Häfen an der Nordinsel nach Auckland alle an der Ostküste gelegen, würden wir jetzt auf der Südinsel die Häfen an der Westküste abklappern
Gleich nach dem Mittagessen brachte uns ein Bus nach Christchurch.
Christchurch war 2011 in den Schlagzeilen, weil durch ein schweres Erdbeben Teile der Stadt zerstört wurden und 185 Tote zu beklagen waren. An der Beseitigung der Schäden wird heute noch gearbeitet.
Konkrete Pläne für Christchurch hatten wir nicht im Gepäck.
Auf der Suche nach einem WC landeten wir zufällig im Canterbury Museum. Da nirgends Kassenhäuschen oder Einlasskontrollen aufgestellt waren, waren wir, ehe wir uns versahen, mitten im musealen Treiben. Museen sind ja meist irgendwie verstaubt und langweilig, was hier keinesfalls zutraf.

Auf der Reise durch virtuelle 3-D-Welten. Man glaubt tatsächlich, das, was man in unmittelbarer Nähe sieht, auch anfassen zu können - und greift ins Leere.
Statt, wie geplant, wieder zum Ausgang zu gehen, trieben wir von einer Abteilung zur anderen. So kamen wir z.B. zur New Zealand Air Sonderausstellung, wo wir zum ersten Mal VR (Virtuelle Realität) erleben konnten.
Oder wir liefen durch eine Straße, wie sie im 19. Jahrhundert ausgesehen haben mag, mit Läden und kleinen Handwerksbetrieben.
Auch der völkerkundliche Teil war so gut gestaltet, dass man, von Neugier getrieben, die Suche nach dem Ausgang vergaß.
Irgendwann war es dann doch Zeit, das Museum zu verlassen. Am den Ausgängen waren Spendenboxen aufgestellt und Schilder baten um eine „Donation“ von 5 NZD (knapp 3,50 €) pro Person. Erstaunlich wenig Museumsbesucher sind dieser Bitte gefolgt
Da wir noch ein ganz klein wenig Zeit hatten, machten wir noch einen kurzen Abstecher (10 Minuten Fußweg) zur durch das Erdbeben zerstörten Kathedrale, ehe uns der Tansferbus wieder zum Schiff zurück brachte.
Gestern Abend waren genau 50% unserer Reise vorbei, was zur der Erkenntnis führt, dass auch die längste Reise einmal zu Ende gehen wird, eine Binsenweisheit, die wir bisher gerne verdrängt haben.
71. Reisetag - Mittwoch, 01.03.2017 Akaroa/Neuseeland
Akaroa ist eine kleine 600-Seelengemeinde in der Region Canterbury nur ein Katzensprung von unserem gestrigen Ziel Lyttleton entfernt. Diesmal lagen wir nicht in einem Containerhafen, dafür aber auf Rede.
Als wir um 9.30 Uhr zum Tender-Treffpunkt auf der Artania eintrafen, wurde gerade mit dem Boarding begonnen, also keine Wartezeit. Man darf ja auch mal Glück haben.
Da unser heutiges Konzept für den Vormittag vorsah, kein Konzept zu haben, beobachteten wir an der Tenderpier erst mal das dortige rege Treiben an den Anlegestellen der Ausflugsboote.
An der Straße an der Küste stach uns ein echter Oldtimer ins Auge, mit dem eine halbstündige Fahrt durch den Ort und zu diversen Aussichtspunkten angeboten wurde. Mit dem Fahrer, Jack, wurden wir schnell handelseinig. 60 NZD (knapp 40 €) sollte die Fahrt kosten, für neuseeländische Verhältnisse ein echtes Schnäppchen.
Jack erklärte uns während der Fahrt dies und das, Interessantes und Uninteressantes über die einzeln Häuser und Gebäude oder die Leute, die er hier kannte und ein wenig über die Geschichte des Ortes. Jack war ein echtes Original.
Ganz wichtig war auch, dass Doris beim Linksabbiegen, die auf der linken Seite im Fond saß, ihren Arm ausstreckte, denn zum einen hatte der Wagen keinen Blinker und zum anderen saß der Fahrer ja rechts, sodass dessen Arm zum Rausstrecken auf die linke Seite zu kurz war.
Die Fahrt machte Spaß, die Leute am Straßenrand winkten uns zu, Jack ließ die rostige Hupe ertönen und wir kamen uns vor wie Gräfin und Graf Cox.
Zum Mittagessen fuhren wir gar nicht erst zurück, denn kurz nach eins startete ein Ausflug mit dem Bus Die Ausflugsbeschreibung las sich wörtlich wie folgt:
Landschaftlich reizvoller Transfer über die Banks Peninsula zur Manderley Farm. Sie erleben eine Schafschur und den Umgang des Farmers mit den Hirtenhunden. Anschließend erholsame Pause bei Tee/Kaffee und hausgemachtem Gebäck. Spazieren Sie durch den Garten der Farm, bevor Sie zur kleinen Barry Bay Käserei zur Besichtigung und Kostprobe weiterfahren. Anschließend Rückkehr zur Anlegestelle.
ca. 4 Stunden/Preis 98 € pro Person
Aber der Reihe nach. Die Landschaftsfahrt war super. Man kann sich an dem bergigen und grünen Panorama nicht satt sehen.
Die Schaffarm hat sich mittlerweile auf Vorführungen für Touristen spezialisiert und die Schafzucht wurde deutlich zurückgefahren. Die 15 Minütige Demonstration mit den Hunden sah wie folgt aus:
5 Schafe weideten an einem Berghang. Ein Hund, der seine Kommandos vom Farmer durch Rufen und Pfeifen erhielt, stürmte den Hang hinauf und trieb die Schafe tatsächlich den Hang hinab bis in die Koppel wo der Farmer und wir Touristen das Schauspiel beobachteten.
Böse Zungen behaupteten, die Schafe hätten auch ohne Hund gewusst, dass sie zu uns auf die Talkoppel laufen sollten.
Im zweiten Teil dieser Vorführung wurden die 5 Schafe wieder den Berg hinaufgejagt.
In einer Halle wurde uns die Kunst der Schafschur gezeigt. Dazu fing der Farmer in einem für uns nicht einsehbaren Stall ein Schaf ein. Auf Grund des hörbaren Getöses und Getrampel war zu vermuten, dass das so eingefangene Schaf mit dem ihm aufgezwungenen Friseurtermin keinesfalls einverstanden war.
Der Farmer klemmte das Schaf zwischen die Beine und mit Hilfe der elektrischen Schere war das Schaf innerhalb weniger Minuten pudelnackt - gekonnt ist gekonnt!
Der Tagesordnungspunkt „Spaziergang durch den Garten der Farm“ war ebenfalls schnell abgehakt. Ein hübscher Garten rund um das kleine Wohnhaus mit einer Wiese und einigen Blumenbeeten, so wie man ihn auch aus Deutschland kennt.
Da wir Kaffee- und Teestunde im Garten um 15 Minuten verkürzt hatten, erhielten wir als Bonus einen Stopp am Strand mit den bunten Kieseln. Ich sah allerdings soweit das Auge reichte nur graue, hellgraue, mittelgraue und dunkelgraue Steine. Bei meiner Suche fand ich schließlich dann doch einen ovalen, schön glatt geschliffenen Kiesel in einem erfrischenden Steingrau.
Unser örtlicher Reiseführer behauptete später im Bus, er hätte einen grünlichen Kiesel gefunden.
Der Höhepunkt der Bustour war die Besichtigung einer Käserei. So zumindest unsere Erwartung. Geboten wurde ein kleiner verkaufsladen, indem wir knapp 50 Busleute uns auf die Füße traten. Ein Mitarbeiter der Käserei erzählte uns im Telegrammstil wie hier aus Kuhmilch der in Neuseealand (und England) weit verbreitete Cheddar-Käse hergestellt wird.
Es gab ein paar gewürfelte Pröbchen und die Besichtigung der Käserei fand durch ein Fenster statt, welches in die Wand zwischen Verkaufsraum und Produktionshalle eingelassen war. Produktion fand keine statt (Feierabend?) alles war geputzt und teilweise mit Tüchern abgedeckt.
Das soll eine Besichtigung einer Käserei gewesen sein. Ich schreibe nicht gerne so böse Wörter, aber das hier ist 100-prozentige Touristenverarsche!
Ich denke, ich sollte auch Tourenveranstalter werden, eine Sightseeing-Attraktion habe ich jetzt schon im Programm:
72. Reisetag - Donnerstag, 02.03.2017 Port Chalmers/Neuseeland
Früh um 7.00 Uhr haben wir an der Pier von Port Chalmers festgemacht. Port Chalmers ist ein Örtchen mit 1600 Einwohnern. Der nächst größere Ort, Dunedin, ist 15 Kilometer entfernt und zählt mit 120.000 Einwohner mit zu den größten Städten Neuseelands.

Freies WiFi ist besonders für die Crew von immenser Wichtigkeit.
So können sie Kontakt zur ihren Familien halten
Eine Lagerhalle am Hafen diente als Tourist-Information und wie es sich für Neuseeland gehört, war hier alles wieder perfekt. Selbstredend freies WiFi und die Damen am Schalter konnte perfekt Auskunft geben. So erfuhren genau mit welchen Bussen des ÖPNV (öffentlicher Nahverkehr) wir nach Dunedin und zurückkommen können und wann sie abfahren. Auch die Haltestellen wurden uns in einen der ausliegenden Stadtpläne exakt eingezeichnet und so stand unserem Trip nach Dunedin nichts mehr im Weg.
An der Bushaltestelle warteten bereits zwei weitere Paare, als ein Minivan-Taxi vorfuhr, seine Passagiere auslud und dann mit uns über einen Sammeltransport verhandelte. Schnell war man sich einig und so kamen wir schnell und bequem zum Bustarif (5 NZD/Person) ins Zentrum von Dunedin
Die Möglichkeit die große Schokoladenfabrik „Cadbury“ zu besichtigen nahmen wir nicht war, obwohl die Besichtigung hier sicher etwas vorteilhafter verlaufen wäre als die gestrige bei der Käserei.
Das Zentrum von Dunedin nennt sich „The Octagon“ (das Achteck). Ein Blick auf den Stadtplan erklärt diese Namensgebung. Die Stadt wurde Mitte des 19.Jahrhunderts von schottischen Siedlern als New Edinburgh gegründet und das Stadtbild erinnert an vielen Stellen an die schottische Hauptstadt.
Am historischen Bahnhof werden für Touristen verschiedene Fahrten in historischen Zügen angeboten, was wir mit Interesse studierten - Fahrtdauer zwischen 90 Minuten und 7 Stunden, je nach gewählter Tour.
Wir entschieden uns spontan für die 90-Minuten-Variante, die am frühen Nachmittag starten sollte. „The Seasider“, so nannte sich der Zug und der fuhr, der wie der Name erraten lässt, größtenteils an der Küste entlang fährt.
Wir erhielten unsere Tickets (einschl. Platzreservierung) und verkürzten uns die Wartezeit bis zur Abfahrt in einem nahegelegen äußert urigem Café.
Pünktlich auf die Minute fuhr der Zug los und dass das neuseeländische Panorama uns wieder restlos begeisterte, brauche ich wohl nicht extra zu erwähnen.
Als besonderen Service für die Handvoll Kreuzfahrer auf dem Seasider hielt auf der Rückfahrt der Zug mehr oder weniger auf freie Strecke in der Nähe unseres Liegeplatzes. Selbstverständlich stellte der Zugmanager (so wird hier der Schaffner bezeichnet) mangels Bahnsteig einen Trittschemel bereit, um einen bequemen Ausstieg zu gewährleisten.
Bevor wir zurück zum Schiff kehrten machten wir noch kurze Abstecher in die örtliche Kirche und das maritime Museum.
Zurück auf dem Schiff stellten wir fest, dass unser am Morgen erworbenes Knowhow bezüglich öffentlicher Nahverkehr ungenutzt verpufft war. Aber das ist ja aber gerade das Schöne an unserer Reise, man weiß im Voraus nie so genau, wie der Tag tatsächlich verlaufen wird.
73. Reisetag - Freitag, 03.03.2017 Bluff/Neuseeland
Bluff (1.800 Einw.) ist südlichste Ortschaft der neuseeländischen Südinsel. Sie bildet nach Invercargill (52.000 Einw.) selbst die zweitgrößte Ortschaft im Stadtdistrikt von Invercargill.
Und zum ersten Mal seit dem Auslaufen aus Genua hatten wir heute so richtig schlechtes Wetter. Zwar wurden die Temperaturen bereits immer herbstlicher, je mehr wir nach Süden fuhren, also uns vom Äquator entfernt haben, aber es blieb weitgehend trocken.
Am Vormittag fuhren wir trotz Regens mit dem über Phoenix gebuchten Bustransfer nach Invercarill - gebucht ist gebucht.
Da der Regen nicht aufhörte und außer einem Park, einem Museum und einen kleinen Zoo laut Reiseführer nicht viel mehr geboten wurde, beschlossen wir, uns für die 2½ Stunden bis zur Rückfahrt in der Hauptgeschäftsstraße rumzudrücken. Sämtliche Geschäfte haben hier breite Vordächer, sodass man nur beim Überqueren der Straße der unwirtlichen Witterung ausgesetzt war.
Das einzig erzählenswerte zu unserem Stadtbummel ist, dass beim Sichten eines Friseursalons Doris sich einen Haarschnitt verpassen ließ. Geplant war dies zwar schon länger, aber bisher war dazu eben keine Zeit, schließlich sind wir vielbeschäftigte Urlauber.
Allerdings musste sich Doris einen Termin geben lassen, wir sollten in 20 Minuten wiederkommen.
Die Zeit nutzen wir, einen großen Trödelladen zu erforschen. Solch ein Sammelsurium hatten wir noch nicht gesehen. Bei den Schallplatten (grob geschätzt 1000 Stück?), die kreuz und quer gestapelt waren, entdeckte ich eine LP „Heintje - seine schönsten Lieder“. Es wäre sicher interessant zu wissen, wie die Platte ihren Weg nach Neuseeland und von dort in den Laden gefunden hat. Porzellan, 1 Kubikmeter Notenblätter gestapelt zu einem fragilen Haufen, eine Telefonanlage, Grammophone, es gab eigentlich nichts, was es nicht gab.
Der Friseur, der Doris die Haare schnitt war auch sehr sehenswert. Mit der hochgesteckten Damenfrisur und dem Kinnbart erinnerte er sehr an Conchita Wurst, der Gewinnerin des 59. Eurovision Song Contest im Jahr 2014. Es ist gut so, dass heutzutage das vermeintlich Unnormale nicht nur mehr und mehr toleriert, sondern auch akzeptiert und respektiert wird.
Der Typ verstand übrigens etwas von seinem Handwerk und war, wie die meisten Neuseeländer, denen wir begegnet sind, ausgesprochen nett und sympathisch.
Am Nachmittag blieben wir auf dem Schiff, das Wetter blockierte doch gewaltig unsere sonst natürliche Neugier.
Um 19.00 Uhr verließen wir den Hafen von Bluff, umfuhren die Südspitze von Neuseeland und fuhren den nördlichen Kurs an der Westküste entlang, denn morgen wollten wir in einige Fjorde einfahren, ehe wir nach Westen Richtung Australien abbiegen würden.
Der aufkommende Wind tat sein Übriges, die Wellen wurden höher und höher und die Artania schwankte die ganze Nacht recht ordentlich.
74. Reisetag - Samstag, 04.03.2017 Neuseeländische Fjorde
Die Nacht war sehr unruhig. Aber nicht das Schaukeln war das Problem, sondern ein metallisches Schlagen, als ob im Rettungsboot, das oberhalb über unserem Kabinenfenster hängt, ein schwerer rumliegt Hammer liegt und bei jedem passenden Schwankung gegen die Bordwand hämmert.
Unsere Kabine bekam dadurch das Ambiente einer Schmiede. Zwar hämmerte der Schmidt pro Minute nur ein- bis zweimal, aber in den Pausen dazwischen war der Schlaf nicht besonders fest und gesund.
Da wir nicht davon ausgingen, dass bei diesem Seegang jemand von der Crew irgendwie ins Rettungsboot klettert oder selbiges zu Wasser lässt, um die Ursache des Geräuschs zu finden, ergaben wir uns unserem Schicksal und versuchten doch irgendwie zu schlafen.
Gegen halb vier Uhr morgens hatte ich die Faxen dick und rief bei der Rezeption an. Es kamen tatsächlich 2 Leute und ich zog mich rasch an und begab mich ebenfalls nach draußen aufs Promenadendeck. Hier pfiff der Wind so (laut)-stark, dass man das störende Geräusch nicht so doll wahrnehmen konnte wie in der Kabine und es kostete ein wenig Überzeugungskraft, die zwei Männer zu motivieren die Ursache zu suchen. Und tatsächlich, eine nicht richtig gespannte Stahltrosse schlug gegen einen Eisenträger und diese Schläge übertrugen sich durch die metallene Schiffswand in die Kabine. Das Stahlseil wurde neu gespannt und fixiert - und Ruhe war.
Ich war jetzt eigentlich jetzt fast munter, denn so eine Brise der Windstärke acht um diese Uhrzeit erfrischt richtig.
Am Morgen nach dem Frühstück erzählten unsere Kabinennachbarn, dass sie den Lärm zwar auch gehört hätten, aber darüber eingeschlafen seien. Vielleicht hätte ich am Abend mehr Bier trinken sollen?
Eine Schiffspassage durch Fjorde ist immer ein Erlebnis, egal ob in Norwegen, Chile oder Grönland. Auch hier war der Mensch wieder ganz klein und die Berge und die Natur ganz groß. (Berge bis zu 1200 Meter)
Auch hier habe ich wieder versucht, die einzigartige Atmosphäre fotografisch einzufangen und wieder ist es misslungen.
Am Vormittag war das Wetter noch regnerisch, sodass man sich das Naturschauspiel von innen durch die Panoramafenster anschaute.
Am Nachmittag klarte es dann auf und die Sonne ließ sich blicken. Das war auch wichtig, denn ab 15.30 Uhr wurden in der Kopernikus Bar Waffeln gebacken, die man sich zusammen mit Kirschen, Eis und Schlagsahne noch aufpeppen lassen konnte. Zur Erinnerung, die Kopernikus Bar befindet sich in der Mitte des Schiffs ganz oben auf dem Außendeck und Regen ist hier deshalb kontraproduktiv.
Es war interessant, die unterschiedlichen Stimmungen in den Fjords zu erleben. Einmal bei trüben und bedeckten Himmel, die Gipfel der steil aufragenden Berge in Nebelschwaden gehüllt war die Stimmung eher mystisch und verwunschen.
Im Sonnenschein kommt dann die ganze Größe und Mächtigkeit der bewaldeten Felswände zur Geltung
Der Vollständigkeit wegen hier noch die Namen der von uns befahrenen Fjorde:
- Dusky Sound
- Doubtful Sound
- Milford Sound
Als wir am späten Nachmittag den Milford Sound verließen und uns wieder im offenen Meer befanden und Kurs Richtung Westen auf Australien nahmen, schlugen Wind und Wellen wieder zu.
Auf Wiedersehen Neuseeland!
75. Reisetag - Seetag, 05.03.2017 Seetag
Wir hatten immer noch schwere See.
Für den heutigen Seetag versprach auch das Tagesprogramm nichts Besonderes.
Wir frühstücken mittlerweile nicht mehr im Lido-Buffet-Restaurant sondern im „Restaurant Artania“. Das Frühstück wird in allen Restaurants in Buffetform gereicht. Der Vorteil im Lido ist der, dass an der Essenausgabe ein Eierkoch positioniert ist, der individuell nach Wunsch die Eier zubereitet. Mein Morgeneibestellung sieht wie folgt aus; „Bitte ein* Spiegelei mit Käse und Zwiebeln, zusätzlich einmal kurz in der Pfanne wenden.“
*Wenn man nur „Spiegelei“ bestellt, erhält man standardmäßig zwei Eier.
Das Lido ist aber mittlerweile beim Frühstück sehr stark frequentiert, so dass hier ständig ein hektisch Gewusel herrscht. Irgendwann habe ich er fahren, dass es auch in den beiden anderen Restaurants - neben dem „Lido“ und dem „Artania“ gibt es auch noch die „Vier Jahreszeiten“) bei den Kellnern, die Kaffee einschenken und einem den Orangensaft bringen, durchaus individuelle Bestellungen aufgeben kann.
Das „Artania“ ist ein sehr schönes Restaurant, nicht so groß wie die „Vier Jahreszeiten“ und beim Frühstück nur zu einem Drittel gefüllt. Der Service ist super. Mittlerweile braucht man gar keine Bestellung mehr aufgeben. Für Doris das 6-Minuten-Ei, Kaffee erst einschenken, wenn sie am Buffet Brötchen, Wurst und Marmelade geholt hat, ein Kännchen heißes Wasser, weil der Kaffee zu stark ist, deshalb dann die Tasse nicht ganz voll machen, einmal Orangensaft, einmal Multivitaminsaft, Tee für den Herrn des Hauses und natürlich sein Spezialspiegelei. Das alles haben „unsere“ Kellner im Kopf.
Beim letzten Etappenwechsel in Auckland wechselten auch die für unseren Tisch zuständigen Kellner (wir sitzen fast immer am gleichen Tisch). Die neue Truppe musste aber von uns nicht neu „angelernt“ werden, sondern waren von ihren Vorgängern bereits umfassend informiert und instruiert worden.
So ist und bleibt das Frühstück jeden Tag nahrungstechnisch gesehen der Höhepunkt des Tages.
Zum Mittag- und Abendessen gehen wir nach wie vor ins Lido, weil das Speisen a la Menü in den Restaurants sehr zeitaufwendig ist und man dann auch essen muss was auf den Tisch kommt. Welche Beilage und welches Gemüse zum Fleisch oder Fisch gereicht wird, bestimmt der Küchenchef.
Im Lido hingegen stellt man sich das Menü so zusammen, wie man es mag
76. Reisetag - Montag, 06.03.2017 Seetag
Nachdem ich die letzten Beiträge für den 9. Blogeintrag geschrieben und die passenden Fotos ausgesucht und in die Texte platziert hatte konnte alles auf den Internetserver hochgeladen werden und online gehen.
Ins Gästebuch wird immer mal wieder irgendwelcher Müll in polnischer Sprache hinterlassen. Es geht wohl um Kreditangebote. Ich glaube aber nicht, dass
Die Leser des Blogs hierfür die richtige Zielgruppe ist, zumal völlig unklar ist, ob der Kredit in polnischen Zloty oder Euros ausgezahlt werden soll.
77. Reisetag - Dienstag, 07.03.2017 Hobart/Australien
Australien! Wir waren angekommen. Zwar noch nicht auf dem Festland, aber auf Tasmanien, einer 250 Kilometer südlich des australischen Kontinents gelegene Insel und dort in Hobart, der Inselhauptstadt mit 220.000 Einwohnern.
Von den touristischen Zielen in und um Hobart sprach mich der Bonorong Wildlife Sancturay am meisten an, ein Wildpark 25 Kilometer von Hobart entfernt.
Im Hafengebäude empfahl man uns, die in einigen Gehminuten erreichbare Touristinformation im Stadtzentrum bezüglich eventueller Busverbindungen zum Wildpark zu fragen. Der Weg dorthin war narrensicher. Große grellgelbe Plakate mit Pfeilen, wiesen uns den Weg. Das Überqueren der (wenig befahrenen) Straße gleich hinter dem Hafengebäude war ungefährlich, weil zwei Männer in der Funktion einer Art Schülerlotsen den Verkehr anhielten (auch wenn kein Fahrzeug weit und breit zu sehen war), damit wir unversehrt die Straße überqueren konnten.
Bevor wir uns weiteren Straßenüberquerungen aussetzen mussten, trafen wir auf ein Ehepaar, das gerade mit einem privaten Touranbieter verhandelte. Für 75 AUD (Australische Dollar) pro Person, das sind umgerechnet knapp 55 Euro, bot er eine 4 stündige Tour an, die auch den Wildpark mit einschloss. Wir schlossen uns dem Ehepaar an, allerdings sollte die Mindesteilnehmerzahl 6 Personen betragen. Wir sprachen deshalb alle vorbeikommenden Artania-Passagiere dass jeder Staubsaugervertreter vor Neid erblasst wäre, allerdings ohne Erfolg.
Zum Glück war unser Fahrer klug genug die Tour dann doch mit nur uns Vieren durchzuführen (Spatz in der Hand - Taube auf dem Dach).
In einem bequemen Minivan fuhren wir zunächst nach Manier einer Stadtrundfahrt alle möglichen Gebäude und Plätze ab, wobei uns der Fahrer in sehr gut verständlichem Englisch über das gesehene informierte. Aber bis auf das Spielcasino mit Drehrestaurant habe ich das meiste schon wieder vergessen.
Dann verließen wir die Stadt, um den 1271 Meter hohen Mount Wellington zu „besteigen“. Wir hofften, dass sich die Wolken noch verziehen würden, die am Morgen den ganzen Berg verhüllten.
Auf gut 2/3 der Höhe des Bergs hatten wir schon die Wolkendecke erreicht und beim Blick aus dem Fahrzeugfenster man hatte eher das Gefühl in einem Flugzeug als in einem PKW zu sitzen.
Am Gipfel angekommen hatten wir ideale Bedingungen. Links eine dichte Wolkendecke unter uns, rechts freie Sicht auf Hobart und die Bucht, in die wir mit der Artania am Morgen eingelaufen waren. Und natürlichen herrlicher Sonnenschein. Wir hielten uns hier relativ lange auf, weil man von dem Blick und den Eindrücken gar nicht genug bekommen konnte.
Aber wir wollten ja noch in den Wildpark, wo wir nach knapp 30 Minütiger Fahrt ankamen. Die 15 AUD Eintritt waren (absprachegemäß) nicht im Fahrpreis enthalten. Unser Fahrer ist wohl ein offizieller Guide, denn er führte uns (ohne Eintritt zu zahlen) mit den entsprechenden Erklärungen durch den Park.
Was sofort ins Auge fiel, waren die vielen frei laufenden Kängurus, Auf dem Gelände tummelten sich bestimmt an die hundert oder mehr dieser Tiere. Man durfte die Kängurus füttern. Einige waren an unseren Tüten mit dem Futter sehr interessiert, andere lagen nur faul rum, bequemten sich aber dann doch zu fressen, wenn man ihnen das Futter direkt vor die Nase hielt.
Natürliche hatten diese handzahmen Exemplare wenig mit der in freier Natur lebenden Tiere gemein, aber zumindest rochen sie ein wenig streng, was eine gewisse Authentizität vorgaukelte.
Auf jeden Fall war es ein sehr schönes Erlebnis.
Alle anderen Tiere konnte man in Freigehegen manche auch in Käfigen ansehen. Hierleistete unser Fahrer gute Dienste, denn einige Tiere war gar nicht so einfach zu entdecken.
Auch hatten wir das Glück, dass einer der Tasmanischen Teufel, die eigentlich tagsüber schlafen, sich ab und zu mal kurz blicken ließ, indem er aus seinem Versteck im Freigehege hervorkam, eine kleine Runde drehte und blitzschnell aber auch wieder verschwunden war.
Meist erwischte man mit dem Fotoapparat nur die Rückansicht des Tasmanischen Teufels.
Der Gang durch das Parkgelände war auch deshalb sehr schön, weil sich hier nur wenige Besucher tummelten. Das änderte sich allerdings schlagartig, als zwei Busslsadungen vollgepackt mit Artania-Leuten durch den Eingangsbereich strömten. Vor der Toilette bildete sich sofort eine Schlange, für die Kängurus stand jetzt wohl gefüttert werden bis zum Umfallen auf dem Programm, auf jeden Fall war es mit der Idylle endgültig vorbei. Aber wir waren gerade dabei, den Park zu verlassen, sodass wir unseren Reisekollegen das Areal kampflos überlassen konnten.
Dieser plötzliche Ansturm gab uns die Gewissheit, heute alles richtig gemacht zu haben. Zwar war unsere Tour nicht unbedingt billiger als ein buchbarer Ausflug bei Phoenix. Aber so exklusiv wie wir kutschiert und betreut wurden, ist es in einer 50-Mann-Gruppe eben nicht.
Australien, damit verbindet man automatisch die Begriffe Ayers Rock und Great Barrier Reef. Um es vorwegzunehmen, da werden wir nicht hinkommen. Das Great Barrier Reef ist völlig außerhalb der Reichweite unserer Schifffahrtsroute, aber zum Ayers Rock hätte man per Phoenix-Ausflug sogar hingelangen können. Allerdings handelte es sich hierbei um einen 4-Tage-Trip mit Flug für 1990 Euro. Die Abreise vom Schiff wäre gleich morgen in der Frühe um 3 Uhr gewesen, die Wiedereinschiffung am 11.3. in Sydney. Für uns zu teuer und zu stressig.
78. Reisetag - Mittwoch, 08.03.2017 Port Arthur/Australien
Port Arthur, nur wenige Seemeilen von Hobart entfernt, ist eine Halbinsel, und war im 19. Jahrhundert die größte Sträflingskolonie Australien. Große Teile des Gefängnisgebäudes stehen noch und sind die „Hauptattraktion“ eines großen Freilichtmuseums mit Häusers und einer Kirchen aus der damaligen Zeit Das Ganze ist eingebettet in einen großen gepflegten Park mit alten Bäumen, Blumen und Wiesen. Ein Besucherzentrum und ein Museum gehören ebenfalls dazu.
Im Museum konnte man nachvollziehen, wie inhuman der englische Strafvollzug war.
Wir durchkämmten den Park, tranken dann noch einen Kaffee (wo es selbstverständlich auch freies WLAN gab), um nach fast 4 Stunden Landgang mit dem Tender wieder auf die Artania zurückzukehren.
Als wir gegen 16 Uhr zurückkamen fand Doris Glückwünsche von Phoenix und vom Housekeeping in der Kabine vor. Doris hatte, passend zum heutigen Weltfrauentag, nämlich Geburtstag. Aus Deutschland waren diesbezügliche Grüße noch nichts eingetroffen; kein Wunder, dort war es ja erst gerade mal 6 Uhr morgens.
79. Reisetag - Donnerstag, 09.03.2017 Seetag
Ein ganz normaler letzter Seetag kurz vor dem Ende einer Reiseetappe. Vormittags Stadtl Frühschoppen mit Freibier, nachmittags Abschiedscocktail (mit Frei-Sekt) und abends das übliche Galaabendessen.
Die Internetverbindung auf dem Schiff funktionierte nicht mehr und die Techniker auf dem Schiff wissen nicht warum In Sydney sollen Experten das Problem lösen.
Doris konnte mittlerweile beim Frühkaffee die Frage klären, warum die amerikanischen Behörden darauf bestehen, dass Schiffe, die in der USA festmachen, an den Kabinentüren Türspione haben müssen. Doris hielt nämlich ein Schwätzchen mit dem Hoteldirektor des Schiffs und der wusste zu berichten, dass auf den großen amerikanischen Pötten eine hohe Kriminalität zu beklagen ist. Vom Raub über Vergewaltigung bis zum Mord ist da wohl alles vertreten. Deshalb die Türspione, damit der Gast, bevor er die Tür öffnet, wenn es klopft, sehen kann wer draußen steht - der Kabinensteward oder der Meuchelmörder.
80. Reisetag - Freitag, 10.03.2017 Sydney/Australien
Wäre ich Phileas Fogg, der Held des Romans “ von Jule Verne „Reise um die Erde in 80 Tagen“, wäre die Reise jetzt zu Ende. Da wir aber zum einen eine andere Reiseroute als Mr. Fogg gewählt haben und uns zum anderen nicht hetzen lassen haben wir noch 58 Tage vor uns.
Sydney ist mit 4,6 Millionen Einwohner die größte Stadt Australiens und die Hauptstadt - nein nicht von Australien, sondern nur - des Bundesstaates New South Wales. Die Australische Hauptstad heißt Canberra und hat nur 350.000 Einwohner.
Aufstehen war heute um 6.00 Uhr, denn das Tagesprogramm empfahl, dass man ab 7.00 Uhr die spektakuläre Hafeneinfahrt auf den Außendecks beobachten sollte. Da durften wir natürlich nicht fehlen. Sobald im Morgendunst die fingernagelgroße Silhouette der Skyline von Sydney auftauchte, begann - klack, klack, klack,... - das Stakkato der Auslöser der Fotoapparate. Auch mein Apparat lief heiß.
Diese Bilder ersten Bilder von Sydney wurden am Abend dann wieder alle gelöscht, denn je mehr sich das Schiff dem Hafen näherte, umso einfacher war es, bessere Fotos zu machen.
An der berühmten Oper (Sydney Opera House) vorbei und unter der Sydney Harbour Bridge durch erreichten wir unseren Liegeplatz. Leider nicht wie erhofft, direkt in der Nähe der Oper und damit nahe am Zentrum. Hier lag bereits die Queen Victoria, ein Luxuskreuzfahrer der Cunard Line. Für uns wäre hier zwar auch noch Platz gewesen, aber wir machten am neuen, etwas abgelegenem White Bay Cruise Terminal fest. Hier ist die Liegegebühr wahrscheinlich erheblich günstiger, als im Premiumbereich von Sydney.
Laut Prospekt sollte es aber, wenn hier im White Bay Cruise Terminal Kreuzfahrtschiffe liegen, eine regelmäßige Fährverbindung geben, die uns für 9 AUD (knapp 6 EUR) in wenigen Minuten zum Circular Quai bringen könnte, also dorthin, wo die Queen Victoria schon lag. Luft- bzw. Wasserlinie zwischen White Bay und Circular Quai war nicht sehr groß.
Leider stellte sich heraus, dass das neue Terminal noch uninteressanter als jeder noch so schäbige Containerhafen war, denn hier gab es null Infrastruktur. Zwar war hier alles recht neu, aber man konnte nicht mal eine Flasche Wasser kaufen und die Fährverbindung war auch nicht in Betrieb. Selbstredend gab es auch keine Internetverbindung.
Phoenix hatte dankenswerterweise für Shuttlebusse gesorgt, die man zum pauschalen Tagepreis von 5 Euro nutzen konnte. Der Bus brachte uns in einer 20-minütigen Fahrt in die Innenstadt.
Das Sydney Tower Eye, ein Fernsehturm, befand sich ganz in der Nähe der Shuttlebus-Haltestelle und es bot sich an, diesen zu „besteigen“. Wir zahlten den für solche touristischen Attraktionen üblichen happigen Eintrittspreis (26 AUD = 18 EUR). Bevor wir mit dem Aufzug auf die in 250 Meter befindliche Besucherplattform fahren durften, mussten wir in einem Kino, jeder ausgestattet mit einer Pappbrille erst einen kurzen 3D-Film anschauen. Auf auf den Skywalk, ein Spaziergang auf einer Außenplattform in 280 Meter Höhe haben wir, wie schon auf dem Turm in Auckland verzichtet, obwohl man hier den Nervenkitzel zum Schnäppchenpreis von nur 70 AUD kaufen konnte.
Nach der Turmbesteigung machten wir uns zu Fuß auf den Weg zum 2 Kilometer entfernten Circular Quai mit einem vorherigen Abstecher zu einer Kirche. Die Kirche fiel in der geballten Ansammlung an Hochhäusern angenehm auf.
Irgendwie scheinen die Wolkenkratzer hier auch dichter zu stehen als in anderen Metropolen. Und hier gab es nicht nur ein oder zwei Hauptgeschäftsstraßen, sondern hier gab es nur Geschäftsstraßen, die Läden waren alles exklusive Geschäfte, nichts für den Normalbürger, also nichts, was uns wirklich gefallen hat.

Blick von Circular Quai auf die Harbour Bridge. Im Vordergrund zwei der vielen Fähren, die hier die verschiedensten Stadtteile verbinden
Vom Circular Quai, wo auch die meisten Fähren abfahren ist es nur noch ein kurzer Weg zur Oper. Vor und auf der großen Treppe am Opernhaus wimmelt es von Touristen, darunter sehr viele Asiaten, in der Hauptsache Japaner, aber auch viele Koreaner.
Zum Opernhaus gehörte auch eine Reihe von Gastronomiebetrieben. Einer davon erstreckte sich etwas 500 Meter entlang der Uferpromenade und war sehr gut besucht. Es bot sich an, hier erst mal eine Kaffeepause einzulegen

Neben den vielen Hochhäusern aus Beton, Stahl und Glas gibt es aber auch zahlreiche Parks, Grünflächen und den Botnanischen Garten.
Dort trifft man überall auf diese Langschnäbel. Es handelt sich hierbei um den Ibis.
Nach dem Opernbesuch wollten wir noch das chinesische Viertel von Sydney besuchen, aber zu Fuß dorthin war es doch ein wenig weit. Am Circular Quay gibt es nicht nur die Anlegestellen für die verschiedenen Fähren, sondern auch eine Station für die Stadtbahn und hier wollten versuchen, per ÖPNV weiterzukommen. Warum auch immer gab es hier am Bahnhof nur 4 Fahrkartenautomaten, zwei links am Gebäude und 100 Meter weiter rechts am Gebäude noch mal zwei und vor jedem Automat hatte sich eine Schlange gebildet, mit Leuten, die mehr oder weniger mit dem Nahverkehrs- und Tarifsystem von Sydney so vertraut waren wie wir. Zum Glück kam uns ein Einheimischer zu Hilfe, der für uns dem Automat die richtige Fahrkarte entlockte und uns noch Zuglinie und Bahnsteig nannte.
Das chinesische Viertel ist mit den Chinatowns in anderen Städten, wie z.B. in San Franzisco oder Singapur nicht vergleichbar, es ist nicht touristisch ausgerichtet. Hier gibt es ganz normale moderne Geschäfte und Läden, die von Chinesen betrieben werden und hier leben und wohnen viele Chinesen. In den chinesischen Garten konnten wir nur einen ganz kurzen Blick werfen, denn er war gerade am Schließen.

Am Rand des chinesischen Viertels:
In der Glasfassade des International Convention Centre (ICC) spiegeln sich die Wolkenkratzer der City
Zur Haltestelle unseres Shuttlebusses konnte man wieder zu Fuß gehen und so kamen wir wohlbehalten, mit etwas wehen Füßen rechtzeitig zum Abendessen wieder auf der Artania an.
Uunser erster Eindruck von Sydney? Na ja!
Aber wir liegen ja mit der Artania hier noch weitere zwei Tage.
81. Reisetag - Samstag, 11.03.2017 Sydney/Australien
An unserem zweiten Tag in Sydney machten wir es uns ganz einfach. Mit dem Shuttlebus fuhren wir wieder in die City, um mit dem Hop-On-Hop-Off-Bus die Stadt zu erkunden und den berühmtesten Strand Australiens, Bondi Beach, (ich wusste von dessen Existenz und Wichtigkeit bis dato rein Garnichts) einen Kurzbesuch abzustatten.
Die nächste Hop-On-Haltestelle (King Street Ecke Elizabeth Street) war schnell gefunden, allerdings wollte der Bus gerade losgefahren, aber er hielt wieder an, als ob uns der Fahrer aus 100 Meter an der Nasenspitze angesehen hätte, dass wir potentielle Hop-On-Hop-Off Kunden wären. Wir siegen also ein, kauften beim Fahrer die Tickets (ca. 30 EUR pro Person), erhielten jeder ein paar schöne rote Kopfhörer und los ging das Soghthseeing. An den Sitzplätzen konnte man die Kopfhörer einstöpseln und die Sprache wählen (deutsch war im Angebot) und die Lautstärke einstellen.
Kleiner Insidertipp am Rande: Sollte jemand mal in Sydney ebenfalls einen Hop-On-Hopp-Off-Bus besteigen, nehmt eure eigenen Kopfhörer mit (3,5 mm Klinkenstecker). Die schönen roten Ohrstöpsel, die man beim Fahrer bekommt, taugen nicht viel und sitzen nicht sehr bequem im Ohr.
Unser erster Ausstieg (Hop-Off) war im Bezirk Kings Cross, dem Kiez von Sydney. Tagsüber sei hier alles solide und erst am Abend würden die leichten Mädchen in Erscheinung treten und die schummrigen Bars öffnen. Der Grund für unseren Ausstieg war vielmehr der El Alamein Fountain, ein außergewöhnlicher Springbrunnen, der unsere Neugier weckte. Der Brunnen ist ein Denkmal für die gefallenen Australischen Soldaten die in den beiden Schlachten von El Alamein in Ägypten im 2. Weltkrieg gefallen waren. Um den Brunnen gruppierten sich diverse Stände, an denen Spezialitäten aus aller Herren Länder angeboten wurde. An manchen Ständen roch es verlockend an anderen roch es für unsere deutsche Nasen eher unangenehm.
Doris kaufte sich einen Zimtdonat, in der Hoffnung ein ähnliches Geschmackserlebnis wie am 21.2.2017 in Auckland. Der Donat stellte sich allerdings als alternatives laktosefreies Dinkelgebäck heraus, an dessen Geschmack man sich erst ganz langsam herantasten musste - kein Vergleich zu Auckland.
Unser nächste Stopp war der Botanische Garten, an dessen nördlichen Ende sich „Mrs Macquarie's Chair“ befinden sollte, ebenfalls ein angeblich Muss für jeden Besucher. Bei dem Chair (Stuhl) handelt es sich um eine steinerne Bank an der Spitze der Halbinsel. Sie wurde1810 von Gefangenen für die Frau des Gouverneurs Macquarie aus Sandstein hergestellt, damit sie die Ankunft von englisch en Schiffen beobachten konnte. Aber der botanische Garten ist groß und eine aus Stein gemeißelte Bank war dann doch nicht so attraktiv, als dass wir uns deswegen die Füße plattlaufen würden
Also wieder Hop-On; unser Ziel war nun die Central Station. Dort wollten wir von der roten Hop-On-Hop-Off Linie in die blaue Linie umsteigen, die zum Bondi Beach führen sollte. Als wir aber an der Busstation die vielen Menschen sahen, die bereits auf den Bus derblauen Linie warteten, blieben wir lieber in unserem Bus sitzen und fuhren weiter. Heute war Flexibilität angesagt.
Nächste Station: The Rocks.
The Rocks ist praktisch die Altstadt von Sydney, hat sich aber meiner Erachtens zum reinen Touristen Viertel gewandelt. Es gab sogar einen Löwenbräu-Ausschank, wo sich meist Japaner an Bratwurst und Schweinebraten versuchten - Kufsteinlied und Herzilein inklusive.
Aber in unmittelbarer Nähe von „The Rocks“ ist der Zugang zur Harbor Bridge. Da wollten wir auch mal drüber laufen, vielleicht nicht den gesamten Weg, aber zumindest ein Stück. Das war eine gute Idee, denn von der Brücke aus hatte man einen prima Blick auf das Opernhaus (besser als vom Fernsehturm) und die Bucht von Sydney, wo sich am heutigen Samstag hunderte von S egelbooten tummelten. Seltsamerweise sah man hier auf der Brücke fast nur junge Menschen. Die Brücke wird hängt zwischen zwei hohen Pylonen, in deren inneren Treppen sind, sodass man auf die Spitze des jeweiligen Pylon gelangen kann. Aber wir dachten, dass der Ausblick ein paar Meter höher auch nicht sehr viel spektakulärer sein kein. Jedenfalls war dieser Brückenspaziergang heute der schönste Teil unserer Besichtigungstour.
Wem der Spaziergang auf dem Fußgängerweg der Brücke nicht genügte, konnte auch den kleinen Umweg ganz oben über den Brückenbogen nehmen, der sogenannte Bridge Climb. Ganz billig ist dieses Vergnügen nicht, es kostet zwischen 200 und 400 AUD (140 - 280 EUR) je nach Wochentag und Tageszeit. Man sieht eigentlich ständig 3 bis 4 Grüppchen a 10 Leuten auf dem Bogen marschieren. Das Geschäft läuft also prächtig.
Recht interessant war auch der Burger, den wir uns anschließend in einem Straßenlokal in den Rocks bestellt hatten. Statt des gewohnten hellen Hamburgerbrötchens, gab es ein dunkles, von Geschmack, Konsistenz und Gesundheitseffekt dem Donat von heute früh nicht unähnlich. Statt Ketchup gab es Rote Beete und statt Mayonnaise war ein Spiegelei zwischen den Brötchen hälften. Der Salat erinnerte im Aussehen stark an Löwenzahn. Der Burger selbst war recht dick und ohne jeglichen Fettanteil, also furztrocken. Serviert ohne Messer und Gabel erforderte es einiges an Geschick, das Ungetüm unfallfrei zu verspeisen.
Die Rückkehr zum Schiff via Hop-On-Bus und Shuttle verlief fast ohne Zwischenfall. Auf dem Weg zurück zur Shuttle-Haltestelle hatten wir im Hop-On-Bus die besten Pätze, nämlich ober und ganz vorne. Das Glück hatte aber ein jähes Ende. Gleich an der nächsten Haltestelle machte unser Bus Feierabend und wir mussten in einen anderen, bereits wartenden umsteigen. Unsere Pole-Position war natürlich futsch.
Am heutigen Tag war auch wieder eine Etappe zu Ende und die meisten Passagiere gingen von Bord und Neue sind im Laufe des Tages angekommen. Jetzt sind wir mit ca. 750 Passagieren 100 weniger als vorher, was Phoenix höchstwahrscheinlich bedauern, aber von uns mit Wohlwollen wahrgenommen wird. Der Titel des neuen 5. Reiseabschnitts lautet: „Von Sydney über Perth nach Bali“
Am Abend beim Übertragen der Fotos auf das Netbook musste ich feststellen, dass mein Fotoapparat nur die letzten 15 Bilder des heutigen Tags auf dem Chip abgespeichert hat.
Das ist zwar Schade, aber keine Katastrophe, zumal Doris auch einige Fotos gemacht hat.
PS. Nachdem ich den Speicherchip neu formatiert hatte, hat die Kamera auch wieder ordentlich gearbeitet.
82. Reisetag - Sonntag, 12.03.2017 Sydney/Australien
Um die Gestaltung des dritten und letzten Tags in Sydney brauchten wir uns keine Gedanken zu machen, denn wir hatten für den Vormittag einen bei Phoenix gebuchten Ausflug in den Featherdale Wildlife Park.
Hier konnten wir noch einmal die meisten Tierarten Australiens sehen, Koalas, Kängurus, Echidnas (Ameisenigel). Wallabys, Wombats, Fliegende Hunde, Pelikane, Dingos und und und …
Ich erspare dem Leser hier für jede der genannten Gattungen ein mehr oder weniger gelungenes Fotos betrachten (bzw. wegscrollen) zu müssen und empfehle stattdessen einen entsprechenden Bildband oder das Internet. Es ist eben doch ein gewaltiger Unterschied ein Tier selbst zu beobachten oder nur ein Foto anzuschauen.
Auf dem jeweiligen Bustransfer vom und zum Schiff erklärte uns ein deutscher Auswanderer, der als lokaler Reiseleiter den Ausflug begleitete, dies und das über Australien im Allgemeinen und Sydney im Besonderen. Da er uns nicht mit Zahlen und sonstigen trockenen Fakten bombardierte, sondern sehr lebendig über die Geschichte, den Alltag und über politische sinnvolle und sinnentleerte Entscheidungen erzählte, war die Fahrt nicht langweilig.
Bei der Fahrt durch die Vororte sah man keine Hochhäuser mehr. Vielmehr sind die Häuser meist einstöckig und die Großstadthektik ist in der City zurückgeblieben.
Auf eine interessante verkehrstechnische Besonderheit machte uns unser Guide aufmerksam. Es gibt auf manchen Straßen sogenannte T3-Spuren. Auf diesen Spuren dürfen nur Fahrzeuge fahren bei denen sich mindestens 3 Personen im Fahrzeug befinden. Und diese privilegierte Spur ist nicht zu verachten, denn selbst am heutigen Sonntag war der Verkehr mehr als dicht. Könnte man über solch ein Konzept in Deutschland auch mal nachdenken? Es könnte durchaus die Bildung von Fahrgemeinschaften fördern.
Den Nachmittag hatten wir „frei“, den wir an Bord verbrachten. Ein weiterer Besuch der Stadt bis zum Auslaufen der Artania war uns für die wenigen verbleibenden Stunden zu Aufwendig.
Um 19.00 Uhr legten wir ab und die Kulisse, die Sydney dabei bietet ist doch etwas ganz besonderes und wir genossen die Ausfahrt auf den Außendecks.
Phoenix spendierte reichlich „Auslauf-Sekt“ und als die Dämmerung einsetzte stand am Himmel ein großer Vollmond.
Kreuzfahrerherz was begehrst Du mehr?
Auch wenn Sydney keine Stadt war in die wir uns verliebt haben und sagen, dass man nicht unbedingt noch einmal hierher müsste, haben wir unsere etwas negative Meinung vom ersten Tag im Laufe unseres Aufenthalts doch korrigiert.
83. Reisetag - Montag, 13.03.2017 Seetag
Am Vormittag fand, wie immer am ersten Seetag einer Etappe, der maritime Frühschoppen statt, also Zeit und Gelegenheit in meinem „Büro“, dem Jamaica Club, meine Hausaufgaben als Blogger zu machen, während die Artania Seemeile um Seemeile Richtung Süden an der Ostküste entlangfährt, um morgen früh in Melbourne festzumachen.
Am frühen Nachmittag sichteten wir ganz nahe beim Schiff auf der Steuerborseite ca. 20 Delfine, die für kurze Zeit schwimmend und springend das Schiff begleitet haben.
Am späten Nachmittag stand der Kapitänsempfang auf dem Programm, also Händeschütteln während der Bordfotograf ein Foto macht. Man hat dieses Ritual diesmal organisatorisch ein wenig gestrafft, indem darum gebeten wurde, dass nur die in Sydney neu zugestiegenen Passagiere das Shake-Hands vollziehen. Viele Passagiere, die mehr als eine Etappe mitfahren, ließen es sich nicht nehmen, sich von ein und demselben Kapitän jedes Mal wieder begrüßen zu lassen. Außerdem gibt es nach dem Händeschütteln immer ein Glas Sekt gratis. Wir selbst gehen schon lange nicht mehr zu den Kapitänsempfängen und bisher hat sich deswegen auch noch kein Kapitän bei uns beschwert oder geäußert, dass er darüber enttäuscht ist. ☺
84. Reisetag - Dienstag, 14.03.2017 Melbourne
Melbourne ist mit 4,5 Millionen Einwohner die zweitgrößte Stadt in Australien. Die Kernstadt selbst hat zwar „nur“ 71.000 Bewohner, aber die Stadt erstreckt sich über fast 10.000 km2, das ist ein Quadrat von 100 km x 100 km, also außerordentlich großflächig.
Dass unsere Anlegestelle knapp 10 Kilometer vom Zentrum entfernt lag, bedeutete letztlich, dass wir genau genommen sehr zentral lagen.
Die Frage, ob wir uns ein Hop-On-Hop-Off-Busticket (25 AUD) zulegen oder eine Tageskarte (15 AUD) für die öffentlichen Verkehrsmittel kaufen sollten, wurde zugunsten der Öffentlichen entschieden. Nicht wegen des Preises, sondern bezüglich gesicherter Aussagen der Abfahrtszeiten und der Hoffnung, mit dem Liniennetz zurecht zu kommen. /p>

War einmal ein Bumerang;
War ein Weniges zu lang.
Bumerang flog ein Stück,
Aber kam nicht mehr zurück.
Publikum – noch stundenlang –
Wartete auf Bumerang.
(Joachim Ringelnatz)
Mit einer Straßenbahn fuhren wir zur Elizabeth Street, um uns von dort aus weiter zum Queen Victoria Markt durchzuschlagen.
„Ein echtes Erlebnis; neben Lebensmitteln ist auch Kleidung, Kunsthandwerk und vieles mehr geboten; geöffnet 6 - 14 Uhr“,
so zu lesen in der Landgangsinformation von Phoenix.
Beim Ausstieg aus der Tram stießen wir auf Tourist-Volunteers, das sind ehrenamtliche Helfer, die Fragen von Touristen beantworten. Eine dieser Helferinnen riet uns ab, mit einer Bahn weiterzufahren, wir sollten lieber zum Queen Victoria Markt laufen.
Also liefen wir den 30 minütigen Weg, den man uns als kurze Strecke beschrieben hatte, bis wir endlich am Markt ankamen. Auf diesem Weg bekam man jedoch einen ersten Eindruck von der der Stadt. Sie ist ganz anders, in unseren Augen nämlich schöner als Sydney. Ein Mix aus modernen und alten Gebäuden, Geschäfte für „normale“ Einkäufer und nicht nur Schicki-Micky-Läden machten die Innenstadt lebenswerter.
Interessant ist auch die Tatsache, dass man hier in einem etwa 2 km x 2 km großen Bereich in der Innenstadt die Straßenbahn und Bus kostenlos benutzen kann.
Den in der Tat sehr großen Markt mit mehreren Hallen und Marktgebäudeselbst durchstreiften wir nur stichprobenartig und waren in einer halben Stunde durch. /p>
Als viel interessanter stellte sich ein Laden mit seinen teilweise skurrilen Artikeln in der Nähe des Marktes heraus. In dem Sortiment von Halloween-, Party-, und Scherzartikel, Faschingskostüme und Haushaltswaren gab es eigentlich nichts, was es nicht gab.
Eine kleine Seitengasse mit gekonnten großflächigen Graffitis stellte für uns eine weitere Sehenswürdigkeit dar, die in keinem Reiseführer beschrieben ist
Auf einem Rundkurs um die City verkehrte eine (natürlich kostenlose) historische Straßenbahn, mit der wir auch fahren wollten. Das wollten unzählige andere Touristen aber auch. So fuhren wir in einer heillos überfüllten Bahn in die Flinders Street am Ufer des Yarra River. Sightseeing funktionierte während der Fahrt nicht so richtig, aber die Informationen vom Band verrieten wenigstens, was man hätte sehen können.
Das Mittagessen nahmen wir in eine Bäckerei ein, wie gewohnt einen Donat für Doris und für mich Würstchen im Schlafrock, bevor wir die nächsten Sehenswürdigkeiten in Angriff nahmen, wie z.B. die Kathedrale und den Bahnhof.
Auf der Terrasse einer Snackbar am Ufer des Yarra Rivers ließen wir den Nachmittag ausklingen ehe wir zurück zum Hafen zur Artania fuhren.
85. Reisetag - Mittwoch, 15.03.2017 Seetag
Wir fahren an der australischen Südküste und wollen morgen früh Adelaide erreichen.
Der heutige Seetag verlief ohne große Ereignisse.
Doris verbrachte eine geraume Zeit im Waschsalon der Artania. Falls es interessiert: Eine Maschine Wäsche kostet 3 Euro (Waschpulver inklusive), die Benutzung von Trocknern und Bügeleisen ist frei.
Ich nutze den „freien“ Vormittag, um die letzten Texte und Bilder im Blog einzubauen. Am Nachmittag geht der 10. Blogeintrag online.
Der Abend bot einen kulinarischen Höhepunkt. Eine von zu Hause mitgebrachte Dose hessischer Presskopf krönte unser Dinner im Lido-Restaurant.
Nach dem Essen besuchten wir die heutige Show in der Atlantic Lounge. Armin Fischer, seines Zeichens Pianist, brachte Humor und Klavierspiel auf einen Nenner. Wir haben Tränen gelacht.
Normalerweise statten wir den Shows nur mal eine kurze Stippvisite ab.
Die meisten Abende bestreitet das Artania-Skow-Ensemble, eine Gruppe von sehr talentierten Sängerinnen, Sänger, Tänzerinnen und Tänzer.
Meist präsentieren sie Oldies, Schlager, Popsongs und Musicalstücke oder führen Mini-Musicals auf, leichte Unterhaltung eben, aber nichts, was uns für eine Stunde, solange dauern die Programme immer, fesselt.
Auch die eingeflogenen Künstler, die einen Reiseabschnitt an Bord bleiben, und in der Regel zwei Abende gestalten, locken uns nicht in ihre Shows, egal ob Bauchredner, Zauberer, Sänger, Geiger.
Wie gesagt, mal eine viertel Stunde hinten im Saal an einem Bistrotisch stehend, das genügt uns.
Es gibt ganz selten etwas, was man nicht schon in irgendeiner Art und Weise auf früheren Reisen gesehen hat.
Aber es gibt ab und an mal Ausnahmen, so wie heute.
86. Reisetag - Donnerstag, 16.03.2017 Adelaide/Australien
Wir machten an der Pier im Hafen mit dem vielversprechenden Namen „Outer Harbor“ fest. Und in der Tat, die Entfernung von Outer Harbor in die City beträgt knapp 20 Kilometer. Aber halb so schlimm, es verkehrt alle halbe Stunde ein Zug ins Zentrum. Die Haltestelle ist nur 500 Meter vom Hafenterminal entfernt.
Obwohl in Australien normalerweise alles sehr teuer ist, kostete die Tageskarte für den Großraum Adelaide nur 10 AUD (ca. 7 Euro).
Wir lassen uns etwas Zeit und fahren erst um 10:30 Uhr los, in der Hoffnung, dass die große Masse der sogenannten „privaten“ Landgänger zu diesem Zeitpunkt die Züge nicht mehr verstopfen. Die Phoenix-Ausflügler sind hierbei unkritisch, die fahren ja mit Bussen.
Unsere Rechnung ging auf und wir fuhren in einem halbleeren Zug in einer 40-minütigen Fahrt nach Adelaide Central Station. Die Hinfahrt war einfach. Vom Hafen fuhr nur eine Linie hierher, da kann man nichts falsch machen. Bei der Rückfahrt musste man dann schon etwas aufpassen, den richtigen Zug zu erwischen. Als wir uns dementsprechend versuchten schlau zu machen, kam unaufgefordert ein Bediensteter auf uns zu, erkannte sofort unsere Absicht und zeigte uns wo die Tafel mit den „Departures“, den abfahrenden Zügen zu finden ist. Toller Service!
Mit dem Stadtplan in der Hand starteten wir unserer Tour. Gleich hinter dem Bahnhof, am Fluss Torrens, lagen das Casino, Convention Center und Festivalcenter, alles Gebäude, die im Stadtplan als sehenswert verzeichnet waren. Und so erfüllten wir brav unsere touristische Pflicht.

Unser weiterer Weg führte uns zum großen Kriegerdenkmal. Australien liegt zwar am „Ende der Welt“, schickte aber in den 1. und 2. Weltkrieg, in den Koreakrieg, in den Vietnamkrieg und diversen anderen Kriegen Soldaten, weil es mit Großbritannien verbandelt war und ist.
Vorbei am alten und neuen Parlamentsgebäude bogen wir ab in die Rundle Mall, eine belebte Fußgängerzone. Im Rahmen eines Kleinkunstfestivals war auch hier eine kleine Bühne aufgebaut, auf der sich diverse Künstler im 15-Minuten-Takt präsentieren konnten.
Eine bemerkenswerte Gruppe - die String Family (zu Deutsch etwa: Familie der Saiten) - fesselte meine Aufmerksamkeit. Mutter (Geige) und Vater (Cello) mit Tochter (Geige) und Sohn (Cello) machten Musik, da ging aber die Luzie ab. Wie man mit so „langweiligen“ Instrumenten eine so fetzige Musik machen kann ist schon toll.
Die 4 Stücke, die sie spielten:
- Ein flottes Irish/Celtic Folk Stück (Titel ist mir entfallen)
- Der Sirtaki von Mikis Theodorakis aus dem Film Alexis Sorbas
- The Devil Went Down to Georgia von der Charlie Daniels Band
- Hava Nagila, das bekannte hebräisches Volkslied.
Dann waren die 15 Minuten der String Family vorbei. Ich würde mir mehr von Künstlern dieses Kalibers auf der Artania wünschen.
Unser nächstes Ziel war der Vorort Glenelg, ein Ferienörtchen mit Strand, dessen Besuch uns in der Phoenix-Landgangsinformation empfohlen wurde. Um dorthin zu kommen, nutzen wir wieder die Straßenbahn, die ungefähr 30 Minuten brauchte.
Da zum einen schon den ganzen Tag ein sehr kräftiger Wind blies und außerdem die Badesaison vorbei war, schließlich ging es hier schon strack auf den Herbst zu, war das Strandleben sehr übersichtlich.
Ein Indoor-Vergnügungspark war leider schon geschlossen. Mit dem Nostalgiekarussell mit Dampforgel und den Karussellpferden wären wir mit Sicherheit gefahren. Das Riesenrad war zwar nicht in dem Gebäude mit dem Karussell, dem Autoskooter und anderen Vergnüglichkeiten untergebracht, sondern wegen seiner Größe outdoor angesiedelt, aber dennoch außer Betrieb.
So blieb Doris nur noch das kleine Trampolin, das, da fest installiert, Sommers wie Winters genutzt werden kann.
Mehr als einen Kaffee trinken und sich ein paar Geschäfte anschauen konnte man hier nicht. Das einzig Erwähnenswerte war der deutschsprechende ägyptische Bäcker.
So fuhren wir mit der Tram zur Central Station, ein Kopfbahnhof, nach Adelaide zurück.
Bevor wir von hier zum Hafen zurückkehrten, erregte eine Art Bildschirmwand unsere Aufmerksamkeit. Man wurde von einer Kamera aufgenommen und als „Lichtgestalt“ auf der Wand abgebildet.
Die Abbildung erinnerte stark an die Frogs aus der Fernsehserie „Raumpatrouille - Die phantastischen Abenteuer des Raumschiffes Orion“.
Nachdem jeder Mal mit entsprechenden Verrenkungen die Bildschirmwand ausprobiert hatte, wurde anhand der großen Anzeigetafel Abfahrtzeit und Bahnsteig der Bahn nach Outer Harbor ermittelt; - gelernt ist gelernt - Abfahrt 18:12 Uhr, Bahnsteig 5, wo ist das Problem.
Das Problem war am Bahnsteig 5 selbst, denn dort wurde eine Abfahrtszeit von 18:15 Uhr und irgendein anderes, uns unbekanntes Ziel, angezeigt. Auch andere Mitreisende von der Artania, die am Bahnsteig 5 eingetroffen waren, waren leicht verunsichert. Leider war weit und breit jetzt kein Bahnbediensteter zu erblicken , den man hätte fragen können, - man fühlte sich fast wie zu Hause bei der Deutschen Bahn AG.

Woran erkennt man in mitten in der Stadt einen Artania-Passagier?
Antwort: An der grünen Phoenix-Tasche!
Diese Tasche hat jeder Passagier bei Reiseantritt in seiner Kabine vorgefunden und sie wird gerne und häufig bei den Landgängen genutzt.
Ich selbst bleibe lieber bei meinem alten Rucksack.
Also wurde gemeinsam mutig beschlossen, dass dies der richtige Zug sein müsse. Ein Ehepaar stieg gleich hinten in den Zug. Aus unerfindlichen Gründen zog der Rest des kleinen Grüppchens weiter nach vorn. Dort löste sich auch die Irritation auf. Auf dem Bahnsteig standen 2 Züge, der Hintere nach Irgendwo, der Vordere um 18:12 Uhr nach Outer Harbour, wie eine weitere Anzeigetafel versprach.
Nur noch 2 Minuten bis zur Abfahrt, aber gerade noch Zeit genug, dass ich im Sauseschritt noch einmal zurücklaufen konnte, um das falsch eingestiegene Ehepaar aus den Zug nach Irgendwo über unsere neuesten Erkenntnisse zu informieren.
Da die Artania heute erst sehr spät, nämlich um 23:00 Uhr ablegen sollte, wäre es trotz eines Ausflugs nach Irgendwo sicher noch möglich gewesen, das Schiff zu erreichen. Aber zumindest das Abendessen auf dem Schiff hätten die Herrschaften sicherlich verpasst.
87. Reisetag - Freitag, 17.03.2017 Penneshaw/ Kangaroo Island /Australien
Die Känguru-Insel (englisch Kangaroo Island) ist nach Tasmanien und der Melville-Insel mit 4405 Quadratkilometern die drittgrößte Insel Australiens. Sie liegt 112 Kilometer südwestlich von Adelaide im Gulf Saint Vincent im Bundesstaat South Australia. (Quelle: Wikipedia)
Wir ankerten in der Nähe des 500-Seelendorfes Penneshaw wohin wir gegen 9:30 Uhr tenderten.
Im Tenderboot berichtete eine „wissende“ Dame, dass es hier nichts gäbe und es unerklärlich sei, wieso wir hier überhaupt Station machen.
Der kleine Ort selbst hatte sich auf unsere Ankunft gut vorbereitet.
Auf dem Football-Platz hatten sie einen kleinen Markt aufgebaut.
Hier buhlten dem neben dem üblichen Kunsthandwerk, ein Heilkräuter-Guru, ein Folksänger, ein Bratwurststand, ein Jongleur, ein indischer Bongotrommler und eine Organisatin, die sich um heimische Raubvögel kümmert um unsere Aufmerksamkeit.
Nachdem wir den gesellschaftlichen und kommerziellen Teil von Penneshaw abgearbeitet hatten, machten wir eine kleine Wanderung am Meer entlang zum Frenchman's Rock, ein Stein, in dem sich der französische Entdecker Nicolas Baudin 1803 verewigt hatte, indem er die Ankunft seiner Expedition dort eingravierte.
Auf der Artania hatten wir die Info bekommen, dass auf Kangaroo Island überall, wie der Name sagt, die Kängurus herumlaufen und viele von den Autos überfahren werden.
Kängurus haben wir keine gesichtet, allerdings hatten wir am Strand Teile eines Skeletts entdeckt.
Leute, die mit dem Bus einen Ausflug gemacht hatten, berichteten, Kängurus gesehen zu haben, wenn auch in größerer Entfernung.
Massentourismus und Tierbeobachtung in freier Wildbahn schließen sich wohl aus. Um echte Tiererlebnisse zu haben, muss man wohl oder übel individuelle Safaris durchführen. Kreuzfahrten sind hierfür denkbar ungeeignet.
Aber der Aussage der Dame aus dem Tender, hier gäbe es nichts, muss ich heftig wiedersprechen. Alleine der Spaziergang am Strand in der schönen Umgebung hat diesen Landgang gerechtfertigt, insbesondere nach dem Besuch von drei australischen Metropolen.
Zum Thema „erzählter Blödsinn“ gab es heute noch eine weitere Episode.
Bei den Überfahrten schaukelte wegen des starken Winds das Tenderboot kräftig immer schön von links nach rechts. (Auf der Kirmes bezahlt man hierfür viel Geld).
Wegen dieser Windverhältnisse brauchte d er Schiffsführermanchmal für das Anlegen und Festmachen des Tenderboots an die Artania mehrere Anläufe. Das Ein- und Austeigen jedoch war absolut unproblematisch.
Daraus machte aber jemand eine Horror-Story und riet einem uns bekanntem Ehepaar dringend von der Überfahrt an Land ab. Da das Ehepaar nicht erkennen konnte, dass man ihnen lediglich ein Schauermärchen auftischte, blieben sie an Bord. Es gibt Menschen die erzählen den größten Mist nur um sich irgendwie wichtig zu machen und von dieser Sorte haben wir einige an Bord.
88. Reisetag - Samstag, 18.03.2017 Seetag
An Bord gibt es bei einigen Mitreisenden bezüglich unseres Kapitäns Jarle Flatebø, seines Zeichens Norweger, harsche Kritik. Man bemängelt, dass er fast kein Deutsch spricht und er beim Kapitänsempfang, bei dem es ein Handshake und ein Foto mit ihm gibt, sich zu wenig herzlich und aufgeschlossen zeigt und auf den Fotos nicht richtig lächelt. Auch ist er eher unsichtbar. erscheint nicht beim Frühschoppen oder Showpremieren und ist nicht zu vergleichen mit dem überall und allzeit beliebten Kapitän Hansen, wie man ihn aus der Dokusoap „Verrückt nach Meer“ kennt.
Unsere Sicht, dass der Kapitän auf einem Schiff in erster Linie dieses ordentlich zu führen hat und seine Mannschaft im Griff haben muss und alles andere zweitrangig ist, wird nicht immer geteilt.
Wir vergleichen den Kapitän gerne mit einem Lokführer bei einer Zugfahrt, der hat auch nur seinen Zug zu fahren und sonst nichts. Das wird aber eben oft so nicht gesehen und die Erwartungshaltung ist die, dass ein Kapitän den Passagieren gegenüber eben gewisse gesellschaftliche Verpflichtungen hat, die er auszufüllen hat. Hat hier eventuell auch das ZDF-Traumschiff und Sacha Hehn zu hohe Erwartungen geschürt?
Ich denke ich werde diese Fragestellung und die verschiedenen Sichtweisen mal in der Facebookgruppe „MS Artania - Fans und Freude“ zu Diskussion stellen. Mal sehen, was dann passiert. Ich vermute, dass ich mit meinem Lokführervergleich gehörig verbale Prügel einstecken werde. Aber Facebook-Dresche tut ja gaar nicht so weh.
89. Reisetag - Sonntag, 19.03.2017 Seetag
Am Morgen kurz vor halb acht, ich stand eingeseift unter der Dusche, hörte auf einmal das Wasser auf zu fließen. Mit den allerletzten Resten aus Dusche und Waschbecken gelingt es mir, dieser vertrackten Situation noch einmal zu entkommen.
Doris, die bevor ich aufstehe, schon beim Frühkaffee weilt, wusste auch von einem kurzen Stromausfall im mittleren Teil des Schiffes zu berichten.
Im Kanal 1 des Bordfernsehens, wo die sogenannte Cruise-Show läuft, das eine Anzeigenfolge von Positions, Geschwindigkeits und Wetterdaten, konnte man sehen, dass die Artania nur noch mit halber Kraft lief. Statt wie mit 16 - 19 Knoten (ca. 28 - 34 km/h), fuhren wir nur noch etwa 7 Knoten.
Informationen, was da los war, erhielten wir erst mal nicht.Man macht sich da schon den ein oder anderen Gedanken.
Gegen 9:30 Uhr nahmen wir wieder normal Fahrt auf.
Um 10 Uhr spricht an Seetagen immer der Kreuzfahrtdirektor über Bordlautsprecher zu uns. Er teilt uns die Schiffsposition mit, wirbt für die diversen Vormittagsveranstaltungen (die auch jeder selbst im Tagesprogramm nachlesen könnte) und informiert gegebenenfalls über Fußballergebnisse. Heute erfuhren wir dann endlich auch, dass die Steuerelektronik einen Fehler gemeldet hätte und deshalb die Maschinen heruntergefahren wurden, um Ursachenforschung zu betreiben. Das Ergebnis war, dass die Elektronik wohl ein wenig gesponnen hat.

Obwohl das Buffet schon lange freigegeben war, hat der Ansturm seltsamerweise noch nicht stattgefunden.
Von 11:30 - 12:00 Uhr fand ein Jazzfrühschoppen statt, wegen des schlechten Wetters diesmal nicht auf dem Außendeck sondern im Foyer des Schiffes.
Es gab Bratwurst und Fleischspieß, dazu australisches Bier. Alles schmeckte prima.
Und nein - wir sind um 12:30 Uhr, als die Restaurants zum Mittagessen öffneten, nicht mehr zum Mittagessen gegangen.
90. Reisetag - Montag, 20.03.2017 Albany/Australien
„Albany, hoch in den Bergen von Norton Green …“, so sang Roger Whittaker im Jahr 1982 (Platz 3 d. deutschen Hitparade).
In dem Lied ging aber um das schottische Albany. Zu dieser schottischen Stadt gehört (noch heute) ein englischer Adelstitel, nämlich „Duke of York and Albany“ und nach einem Frederick, Duke of York and Albany wurde die 1826 gegründete australische Strafkolonie Albany benannt.
So jetzt haben wir die Verbindung zwischen Roger Whittaker und der australischen Stadt Albany, wo wir heute früh um 6 Uhr an der Pier festgenacht hatten, hergestellt.
Wikipedia sei Dank!
Heute waren wir früh dran, schon um 8:30 fuhren wir mit dem von der der Stadt bereitgestellten Shuttlebus (gratis) in das 3 Kilometer entfernte Zentrum.
Obwohl die Stadt 27.000 Einwohner hat, ist Albany-City selbst eine Kleinstadt. Die Stadt dehnt sich aber auf mehr als 80 Quadratkilometer aus, es gibt also sehr viel Umland.
Der Stadtbummel ist schnell erledigt, es gibt viele kleine Geschäfte. Auf dem großen Platz vor der Bibliothek war ein Markt mit einer handvoll Ständen aufgebaut und auf einer kleinen Bühne spielte und sang ein Gitarrenspieler Countrysongs. Die Herbstsonne (heute war hier Herbstanfang) schien noch schön warm und wir setzten uns vor die Bühne und lauschten lange und gerne der Musik.
Damit ist der heutige Landgang auch schon vollständig beschrieben. Um kurz vor 12 Uhr fuhren wir mit dem Shuttle wieder zurück, denn um 12:30 Uhr war „Letzter Einschiffungstermin.
Um 13:00 Uhr legten wir unter dreifachem Tuten mit dem Schiffhorn ab.
Das Tuten wird übrigens mittlerweile angekündigt. Man erinnere sich, vor Panama hat mir das Horn fast das Hirn aus dem Ohr getutet, worauf ich mich bei Phoenix beschwert hatte und angeregt habe, doch vor dem Tut kurz Bescheid zu geben. Man entschuldigte sich bei mir und versprach Besserung.
Dass Phoenix eine Anregung annimmt, ist eher ungewöhnlich und daher in diesem Fall um so erfreulicher.
Heute stand auch noch der Galaabend auf dem Programm, die sogenannte Mittelgala. (Die Begrüßungsgala hatten wir schon, die Abschiedsgala wird noch folgen.) Also binde ich mit brav meine Krawatte um, bevor ich mit Doris zum Abendessen ins Selbstbedienungsrestaurant Lido schreite.
91. Reisetag - Dienstag, 21.03.2017 Fremantle/Australien
Kurz vor 11 Uhr fuhren wir in die Mündung des Swan River ein und machten im Hafen von Fremantle fest. Fremantle ist ein Ort mit knapp 8000 Einwohnern, Ungefähr 20 Kilometer flussaufwärts liegt die Millionenstadt Perth (1,7 Millionen Einwohner).
Unsere Liegezeit war diesmal ein wenig ungewöhnlich. Wir blieben über Nacht in Fremantle liegen, um erst am nächsten Tag um 14:00 Uhr auszulaufen.
Heute Perth und morgen Fremantle, so sah unser Landgangskonzept aus. Aus der Landgangsinformation wussten wir, dass sich der Bahnhof in Hafennähe befindet und Züge nach Perth alle 15 Minuten fahren.
Am Bahnhof half uns ein freundlicher Bahnmitarbeiter beim Fahrkartenkauf am Automaten. So erstanden Doris und ich eine Tageskarte für je 12 AUD und in knapp 30 Minuten waren wir schon mitten im Zentrum von Perth.
Nach Sydney, Melbourne, Adelaide war unser Interesse am Großstadtleben eher eingeschränkt. Der Stadtplan zeigte, dass der Elisabeth Quay am Ufer des Swan River nicht allzuweit von der Central Station Perth entfernt ist und wir aus Erfahrung wussten, das Flussufer in Städten oft recht nette Ziele sein können.
Im Prinzip war unser Plan gar nicht so übel, allerdings machte die Aktion wegen Regen und Wind nicht so richtig Spaß. Bei schönem Wetter wäre es am Elisabeth Quay bestimmt recht hübsch gewesen, man hätte einen Kaffee trinken können und dem Treiben auf und um den Fluss zu beobachten.
Aber so machten wir lieber kehrt und bummelten noch ein wenig durch die Einkaufsstraßen.

Hier wären normalerweise Wasserfontänen aus dem Boden gekommen. Aber Dienstags (und heute war Dienstag) ist immer wegen Wartungsarbeiten das Wasserspiel außer Betrieb. Aber wir hatten ja auch Wasserspiele von oben zur genüge, da konnten wir die fehlenden von unten leicht verschmerzen.
In den Straßen sah man ab und zu Aborigines. Diese Menschen fielen nicht nur wegen ihrer Hautfarbe auf, sondern auch dadurch, dass viele von ihnen barfuß liefen. Ob die fehlenden Schuhe bei diesem kühlen und regnerischen Wetter einfach ihrer Natur entsprachen oder hierfür einfach kein Geld zur Verfügung stand, wissen wir nicht.
Auf der Rückfahrt nach Fremantle, so gegen 15:00 Uhr, stiegen an den verschiedenen Stationen Schüler von verschiedenen Schulen, erkennbar an ihren unterschiedlichen Schulunformen, zu. Dabei handelte es ausschließlich um weiße Kinder und Jugendliche.
Ist unsere Beobachtungen - barfüßige Aborigines und ausschließlich weiße Schülerinnen und Schüler - Zufall oder verbirgt sich dahinter ein Problem beim Zusammenleben der weißen und der indigenen Bevölkerung?
Wikipedia meint zu diesem Thema:
Mangelnde Integration und Diskriminierung der knapp 500.000 Aborigines, die am Rande der Gesellschaft leben, führt dazu, dass im Vergleich zu der Gesamtbevölkerung Australiens (24 Mio.) die Aborigines zum ärmsten Teil der australischen Gesellschaft gehören; ihre Arbeitslosenrate ist mit 20 % fast dreimal so hoch wie die der Durchschnittsbevölkerung. Sie haben einen erschwerten Zugang zur Bildung, ihre Lebenserwartung liegt im Durchschnitt zehn Jahre unter der der weißen Bevölkerung, die Kindersterblichkeit ist doppelt so hoch.
92. Reisetag - Mittwoch, 22.03.2017 Fremantle/Australien
Bis zum Ablegen um 14:00 Uhr hatten die Möglichkeilt, Fremantle zu erforschen. Hierzu boten sich mehrere Möglichkeiten an.
- Mit einem kostenlosen Shuttlebus vom hafen ins Zentrum zu fahren (Fahrzeit knapp 5 Minuten),
- in Bahnhofsnähe mit den kostenlosen(!) Bussen der sogenannten roten und der blauen Linie im Hop-On-Hop-off-Verfahren auf den zwei verschiedene Rundkurse die Sehenswürdigkeiten abzuklappern,
- die nähere Umgebung einschließlich Zentrum zu Fuß abzulaufen.
Das Wetter war heute viel freundlicher als gestern und vor allem regnete es nicht, also entschieden wir uns für die Variante (c).
Zunächst steuerten wir den Fischereihafen an. Er wird mittlerweile hauptsächlich touristisch genutzt. Allerdings ist die Saison schon vorbei, die vielen hübschen lokale, auf Pfeilern ins Wasser gebaut waren ohne Besucher oder ohnehin geschlossen. Auf dem Weg passierten wir das Round House, dass im Reiseführer als „das älteste erhaltene Gebäude in Western Australia, das 1830/1831 als Gefängnis errichtet wurde.“ hervorgehoben wird.

Diese Aluminium-Gitarre nennt sich Dobro, die durch den metallenen Korpous einen ganz besonderen Klang hat. Der Straßenmusiker hier im Cappuccino Strip spielt sie mit der sogenannten Bottleneck-Technik. Er greift nicht nur Akkorde, sondern er zieht auch mit dem Metallröhrchen, dem Bottleneck (Flaschenhals), den er über den Mittelfinger gestülpt hat, über die Saiten und erzeugt so eine „wimmernde“ Tonfolge. Diese Technik wird oft beim Blues verwendet und dieser Knabe hier spielte waschechten Blues.
Durch einen Park gelangte in wenigen Minuten ins Zentrum und dort speziell zum Cappuccino Strip, eine Straße mit vielen Cafés. Natürlich tranken wir dort einen Kaffee.
Im gesamten Innenstadtbereich sind viele Gebäude aus der Kolonialzeit erhalten und erfreuen gut erhalten und restauriert das touristische Auge.
Auf dem Rückweg zum Schiff kamen wir noch an einem Laden vorbei, in dem echte Didgeridoos verkauft wurden. Dieses Instrument, wurde ursprünglich von den Aborigines verwendet. In den meisten Andenkenläden kann man farbenfrohe industriell hergestellte Didgeridoos kaufen, aber diese hier wurden noch handwerklich nach den alten Techniken, nämlich einem 1 - 2,50 Meter langen Eukalyptusstamm, der von Termiten ausgehöhlt wurde, angefertigt.
Der nette Verkäufer gab mir auch eine Kurzanweisung zum Spielen des Instruments, aber ich habe vollständig versagt. Es kam kein vernünftiger Ton aus der Röhre. Leider haben wir vergessen ein historisches Foto von meiner ersten Didgeridoo-Stunde zu machen.
Auch von einem Kauf sahen wir ab, da zum einen der Platz in der Kabine doch sehr eng geworden wäre und der Preis zwischen 700 und 2.000 AUD unsere Urlaubskasse doch arg gebeutelt hätte.
93. Reisetag - Donnerstag, 23.03.2017 Seetag
Heute Nachmittag ging an Bord der Artania der 11. Blogeintrag online, schnell und problemlos. Das war gestern noch ganz anders, das scheiterte der Versuch. Die Internetverbindung war so instabil bzw. bestand gar nicht mehr, dass es nicht möglich war, die 25 MB an Daten (die Größe des 11. Blogeintrags) auf den Server 2017a.pehoelzer.de hochzuladen.
Woran es liegt, dass die Verbindung mal gut und mal schlecht ist, bleibt ein Rätsel. Die Phoenix-Leuten wissen es auch nicht - sagen sie zumindest.
Der Seetag verlief ansonsten ereignislos. Die Show „Timetunnel“, eine Revue, bei der Hits und Evergreens der letzten Jahrzehnte präsentiert werden, lief mindestens schon zum zweiten Mal seit Reisebeginn in Genua. Anderes Shows wurden bereits schon drei und viermal aufgeführt.
Auch das sonstige Animationsprogramm wiederholt sich ständig - das Essen sowieso.
Das stellt für manche Passagiere, die die gesamte Weltreise mitmachen, ein echtes Problem dar, sie fangen an sich zu langweilen.
Nur über die Skatturniere, die an jedem Seetag um 14.00 Uhr im Jamaica-Club durchgeführt werden, habe ich noch nie Klagen gehört. Im Gegenteil, das Spielzimmer ist immer proppenvoll, sodass ich mich beim Bloggen an den Schreibtisch der „Gold- und Silberberatung“, der im Jamaica-Club steht, zurückziehen muss, um nicht unnötig einen Spieltisch zu blockieren. Und 50% der der Skatturnierspieler (davon 3 Spielerinnen) sind Weltreisende, die jedes Mal begeistert wieder dabei sind.
94. Reisetag - Freitag, 24.03.2017 Exmouth/Australien
Wir haben den Sommer wieder eingeholt. Die Sonne war ja nach Norden Richtung Äquator gewandert und wir sind jetzt einfach hinterhergefahren. Wir befinden uns auf ca. 20° südlicher Breite und die Temperaturen bewegen sich so um die 30° Celsius.
Exmouth (2200 Einw.) ist erst 1964 entstanden, und zwar als Dienstleistungszentrum für die nahe gelegenen Kommunikations-Sendeanlagen, deren Sendetürme mit 388 Metern zu den höchsten der Welt gehören. Die Masten haben wir vom Schiff aus sehen können, als wir uns gegen 11..00 Exmouth näherten.
Das war aber schon ziemlich alles, was wir von diesem Ort sahen, denn wir lagen, anders als im Katalog beschrieben, auf Rede und tenderten gegen 14.00 Uhr zum Yachthafen, der ungefähr 6 Kilometer außerhalb des Orts entfernt.
Ausflüge bzw. Einen Transfer in den Ort hatten wir nicht gebucht.
Warum nicht?
Vielleicht erklärt folgende Aufstellung, warum wir verzichtet haben.
| Shuttleservice nach und von Exmouth | 25,00 € | |
| Fahrt mit dem Glasbodenboot | ca. 2,5 Stunden | 109,00 € |
| Schnorcheln am Bundegi Strand | ca. 2,0 Stunden | 129,00 € |
| Bootsfahrt Yardi Creek | ca. 4,5 Stunden | 189,00 € |
| Schnorcheln in der Turquoise Bay | ca. 4,5 Stunden | 199,00 € |
| Walhaisafari am Ningaloo Reef | ca. 6,5 Stunden | 439,00 € |
Für diese Mondpreise sind aber nicht Phoenix sondern die örtlichen Tourenanbieter verantwortlich.
Zum Glück gab es in der Nähe der Tenderpier einen Strand, den man in knapp 10 Minuten zu Fuß erreichen konnte. Es handelte sich dabei um einen kilometerlangen Naturstrand. Naturstrand bedeutete, dass hier keine Liegen und Sonnenschirme zur Verfügung standen und der Strand nicht nur aus feinen Sand, sondern auch aus Steinen und Korallen bestand. Kein Traumstrand also, aber er war sauber und das Wasser mit knapp 30 Grad sehr angenehm.
Nach Sonnenbad und Planschen im flachen Wasser starten wir eine kleine Strandwanderung.
Unsere Sache ließen war einfach an unserem Platz zurück, im Vertrauen, dass hier nichts geklaut wird, denn den ca. 40 anderen Strandbesucher von der Artania trauten wir alles Mögliche zu, aber keine Diebstähle.
Auf unserer kleinen Wanderung trafen wir auf eine Gruppe junger Australier, die Golfbälle ins Meer schlugen.
In einer uns vollkommen unverständlichen Sprache, nämlich Englisch mit heftigen australischem Akzent, boten sie uns an, auch mal einen Schlag zu versuchen. Jeder von uns bekam eine Kurzeinweisung, wie man einen Golfschläger hält, dann ging es los.
Ich durfte zuerst schlagen und hatte Glück, dass ich den Ball, der auf einem Abschlagspinöckel lag (oder wie nennt man den Dorn, auf den der Golfball für den Abschlag platziert wird ?), gut getroffen habe. Der Ball flog weit ins Meer, wohingegen die Flugbahn des Pinöckels kurz vor dem Wasser endete. Der Schlag war allemal besser als z.B. der eines Tiger Woods, der ja anscheinend nicht mal in der Lage ist, den Pinöckel zum Fliegen zu bringen.
Der Schlag von Doris war mehr vom Nachhaltigkeitsgedanken geprägt. Zum einen blieb der Pinöckel, wie bei Profi-Golfern üblich, im Sand stecken, aber der Ball flog nicht sehr weit ins Meer, sodass einer der Jungs die 5 Meter ins seichte Wasser watete und den Golfball zur weiteren Verwendung wieder bergen konnte.
Auf unserem weiteren Weg trafen sprang uns ein mittelgroßer Hund entgegen, der uns sehr deutlich zu verstehen gab, dass wir mit ihm und dem Plastikring, den er im Maul hielt, ein Spiel spielen sollten. Man musste zuerst um den Ring kämpfen. Solange er ihn im Maul hatte, hatte man keine Chance. Das Herrchen, das gemütlich vor seinem Geländewagen saß, bedeutete uns, die Arme einfach hängen zu lassen, dann legte der Hund den Ring auf den Boden. Jetzt kam es darauf an, war schneller zupacken konnten, der Hund oder wir. Manchmal waren wir Sieger und damit der Rest des Spiels klar: Den Ring weit werfen, egal ob in Richtung Strand oder ins Wasser. Der Hunde holte den Ring und das Spiel begann wieder von vorn.
Wäre es nach dem Willen des Tieres gegangen, hätten wir das Schiff verpasst.
Leider konnten wir weder das Golfen, noch das Miteinander von Mensch und Hund für die Nachwelt fotografisch festhalten, da wir ja alle Sachen an unserem Liegeplatz zurückgelassen hatten. Als wir wieder dorthin zurückkamen, war auch noch alles da.
Am Abend besuchten wir den zweiten Auftritt des „komischen“ Pianisten Armin Fischer in der Atlantic Show Lounge.
95. Reisetag - Samstag, 25.03.2017 Seetag
Heute konnte man an der Rezeption für 10 Euro Tickets für den morgigen Shuttlebus vom Hafen in Broome in die City kaufen. Dabei musste man sich für eine Uhrzeit entscheiden, 9:30, 9:50, 10:10 etc. Wir hatten bezüglich Abfahrzeiten noch die freie Auswahl, da wir schon vor dem Frühstück den Kauf tätigten uns entschieden uns für den 10-Uhr-10-Bus.
Am Abend, als das Tagesprogramm für morgen ausgeteilt wurde, konnten wir lesen, dass sich die Ankunftszeit um zwei Stunden nach hinten verschieben wird
Warum und wieso? Darüber schwieg sich das Papier aus.
Blöd nur, dass der Shuttleservice dadurch erst um 10:30 Uhr statt um 9:30 Uhr beginnen sollte, denn wir hatten ja ein 10-Uhr-10-Ticket. Watt nu?
„Kein Problem“ erklärte man uns an der Rezeption, „morgen erfolgen konkrete Lautsprecherdurchsagen, wie das Shuttlen durchgeführt wird.“
96. Reisetag - Sonntag, 26.03.2017 Broome/Australien
Natürlich erfolgte keine konkrete Durchsage. Lapidar wurde verkündet, dass das Schiff für den Landgang freigegeben ist und sofort strömte ein Schub Menschen die Gangway hinuter.
Da es üblich ist, dass Passagiere bereits am Ausgang warten, wenn sich der Dampfer noch auf hoher See befindet, dachten wir uns noch nichts dabei.
So gegen viertel vor elf fragten wir an der Rezeption nach, was mit den Shuttlebussen im Allgemeinen und der Durchsage darüber im Besonderen sei. Ja, das würde direkt am Bus von Konstantin (z.Zt. stellvertretender Kreuzfahrtdirektor) geregelt.
Also packten wir schnell unsere Landgangsausrüstung zusammen und wollten von Bord. An der Gangway stand auch tatsächlich besagter Konstantin und rief: „Noch jemand Tickets für 10:50 Uhr“.
Stolz erklärten wir, dass wir noch viel bessere Tickets hätten, nämlich für den 10.10 Uhr Bus. Da meinte er schnippisch: “Der ist schon lange weg.“. Damit war für ihn der Fall erst mal erledigt. Nach meinem Protest wegen fehlender Durchsage, gestattete er gnädig, dass wir den 10-50er nehmen dürften. Auf die Frage, was wir den falsch gemacht hätten, wurde pampig, wir hätten halt ins Foyer gehen müssen. Unseren Einwand, dass wir da ja gerade waren, ließ er nicht gelten und befahl uns, Ruhe zu geben und zum Bus zu gehen.
Ich schlage hiermit Vize-Kreuzfahrtdirektor Konstantin zum Mitarbeiter des Monats vor, wegen seiner souveränen Kompetenz im Umgang mit Gästen.
Broome ist eine Kleinstadt und war einst eine Hochburg für das Perlentauchen und für die Perlmuttverarbeitung. Geblieben sind viele Schmuckgeschäfte und ein kleines Freilichtmuseum.
Das Gebiet, in dem Broome liegt, war einmal eine Siedlung der Aborigines gewesen. Wir sahen viele ihrer Nachfahren hier in den Straßen, aber wir hatten nicht den Eindruck, dass sie zu den „Oberen Zehntausend“ gehören.
An der Haltestelle des Shuttlebusses im übersichtlichen Stadtzentrum (2 Straßen) boten diverse Tourenveranstaltungen ihre Dienste an. Aber wir wollten weder eine 1-stündige Rundfahrt in die Umgebung für 70 AUD (ca. 50 €) noch einen Hubschrauber Rundflug für 500 AUD (350 €) kaufen, sondern erkundeten das Örtchen zu Fuß.
Auf einem langen Holzsteg (Streeters Jetty) konnte man wegen gerade herrschender Ebbe zwischen Mangroven allerlei Krebsgetier im Sand beobachten.
Unsere nächste Station war das kleines Freilichtmuseum, wo rund um die dort präsentierten alten 2 Seglern über die Arbeit der Perlentaucher informiert wurde.

Zwei bemerkenswerte Kopfbedeckungen.
rechts: Ein alter Taucherhelm, wie ihn die Perlentaucher verwendeten.
links: Ein Sonnenhut, gekauft in Neuseeland.
Das 1906 eröffnete Open-Air Kino „Sun Pictures“ ist heute noch im Betrieb und ist damit das älteste Freiluftkino der Welt.
Bevor wir wieder zum Schiff zurückfuhren, kehrten wir noch ein, um etwas Kühles zu trinken, denn die Hitze und die Luftfeuchtigkeit waren enorm.
Auf dem Schiff machten wir uns schnell frisch und schon ging es wieder raus, denn von der Pier über einen langen Steg konnte kam man direkt zu einem Strand. Und da es verboten war, auf diesem Steg zu laufen, setze die Hafenbehörde zwei Minibusse als Shuttle ein, die ständig vom Schiff zum Ende des Stegs und umgekehrt fuhren.
Am Strand wurden die Hosenbeine hochgekrempelt und los ging es durch den hellen weichen Sand. Der Strand zog sich über mehrere Kilometer (die wir natürlich nicht komplett abgelaufen sind) und immer wieder durch bizarre Fels- und Steinformationen durchsetzt
Auch hier, wie schon in Exmouth, fuhren die Einheimischen mit ihren Geländewagen direkt auf den Strand. Das war aber nicht weiter störend, da der Strand sehr breit und (wie schon gesagt) sehr lang ist.

Gleich am Zugang zum Strand der Erste Hilfekasten bei Verbrennungen durch Feuerquallen - eine Flasche Essig (engl. Vinegar)
Um 19.00 Uhr legten wir ab und verließen somit Australien, um mit Asien einen neuen Kontinent aufs Korn zu nehmen.
97. Reisetag - Montag, 27.03.2017 Seetag
Heute war wieder ein erholsamer Seetag mit Stadl Frühschoppen am Vormittag. Der Abend wurde zu Ehren der in drei Tagen abreisenden Gäste als Galaabend veranstaltet.
Da wir noch nicht abreisen wollten, galt die Gala eigentlich gar nicht für uns. Ich hatte trotzdem meine gute Hose angezogen.
Ich kann diesen Galaabenden mittlerweile auch etwas abgewinnen, denn meist gibt es dann abends gegen halb elf als Late Night Snack in Harry’s Bar „Currywurst in 3 Schärfen“, so auch heute abend..
98. Reisetag - Dienstag, 28.03.2017 Komodo Island/Indonesien
Die Insel Komodo, sie gehört zur Inselgruppe der „Kleinen Sundainseln“, ist bekannt für ihre Warane, die sogenannten Komodowarane, die größte gegenwärtig lebende Echsenart.
Zusammen mit kleineren vorgelagerten Inseln ist Komodo ein Teil des gleichnamigen Nationalparks.
Wir lagen auf Reede und mussten deshalb wieder tendern.
Wir, die Passagiere der Artania, durften nicht einfach als „freilaufender Tourist“ die Insel betreten, sondern ein Landgang war nur in Verbindung mit einem Ausflug möglich. Diesen Ausflug hatten wir auch schon frühzeitig vor Antritt der Reise auf der Phoenix-Internetseite gebucht.
Der Ausflug nannte sich „Rundgang und Besuch der Komodowarane“. Die circa 450 Ausflugswilligen wurden in 11 Gruppen aufgeteilt, die im Abstand von jeweils 15 Minuten mit einer Tenderüberfahrt startete. Wir waren um 10.15 dran, eine Zeit, die sehr gut mit unserem Schlaf- und Wachrhythmus und Frühstückszeiten im Einklang war.
Nach einer Einweisung mit Verhaltensregeln durch einen Ranger marschierten wir los und nahmen den drei Kilometer langen Rundweg in Angriff. Jede Gruppe wurde von 2 Rangern begleitet, einer vorn und einer hinten, bewaffnet mit einem gegabelten Stock, um gegebenenfalls einen übermütigen Waran von uns Touris abzuhalten.
Die Komodowarane, sie werden bis zu 3 Meter lang und bis 70 Kilogramm schwer, sind nämlich gefährliche Raubtiere, die Hirsche, Büffel und sonstiges Getier jagen und reißen. Diese Viecher haben nicht nur scharfe Reißzähne, sondern haben zusätzlich noch eine Giftdrüse. So können sie in aller Seelenruhe warten, bis ein gebissenes Opfer verendet ist, um es dann in Ruhe zu verspeisen.
Ich war etwas skeptisch, ob wir bei diesem Massenansturm diese Tiere überhaupt zu Gesicht bekommen. Aber wir wurden nicht enttäuscht. Die Dramaturgie des Rundgangs war geschickt inszeniert. Gab es für unsere Führer zunächst „nur“ die Möglichkeit Erklärungen über einige Pflanzen abzugeben, kamen wir fast zum Schluss der kleinen Wanderungen an eine Stelle, an der 5 -6 Komodowarane versammelt waren. Gefahr für Leib und Leben der Touristen bestand wohl nicht, denn die Tiere wurden vorher gut gefüttert und lagen faul und vollgefressen herum und interessierten sich für uns überhaupt nicht.
Es war beinahe schon sensationell, als sich einer dieser Komodo Dragons (so die englische Bezeichnung) ein paar Schritte bewegte und seine lange Zunge ausstreckte, mit der das Tier auch kilometerweite Beute riechen kann.
Wir Fotografen waren begeistert.
Ein wirklich gelungener Ausflug. Schon allein der Weg durch den dschungelartigen Regenwald hat uns sehr gut gefallen.
Am Ende des Rundgangs kam man unweigerlich zu den Souvenirständen, wo neben dem üblichen Angebot auch holzgeschnitzte Warane in allen Größen und Formen feilgeboten wurden. Nach Neuseeland und Australien, wo man sich die Waren ungestört ansehen konnte, muss man sich jetzt erst noch an die asiatischen Verkaufsstrategien gewöhnen. Hier wird man bedrängt, bekommt z.B. T-Shirts unter die Nase gehalten („cheap, cheap, good quality“ - in Ruhe Anschauen geht gar nicht. Und man muss natürlich handeln.
Auch Kinder waren in das Geschäft mit den Touristen eingebunden. Einige versuchten kleine Plastikwarane und Postkarten an den Mann zu bringen und andere bettelten.
Gegen 15.00 Uhr waren alle Gruppen durch und wieder zurück an Bord, sodass die Artania 2 Stunden früher als ursprünglich am grünen Tisch einmal geplant, den Anker lichten konnte.
Die gesparte Zeit nutze der Kapitän, um mit der Artania ein wenig zwischen den Inseln und Inselchen zu schippern.
99. Reisetag - Mittwoch, 29.03.2017 Benoa/Bali/Indonesien
Bis wir um 11.00 Uhr an der Pier von Benoa auf der indonesischen Insel Bali festmachten konnte ich noch ein wenig am Blog basteln. Wir aßen auch noch in Ruhe zu Mittag und machten uns dann auf, um zu sehen wie wir den Nachmittag gestalten könnten.

Diese kleinen Opfergaben platzieren die Balinesen vor ihren Häusern und Lädchen, um die Götter freundlich zu stimmen. Auch in jedem Auto steht vorn am Armaturenbrett so ein Kästchen, was beim hiesigen Verkehrsaufkommen und dem ortsüblichen Fahrstil durchaus angebracht ist.
Als wir das Hafengebäude verlassen hatten, hatten andere bereits die Entscheidung gefällt, was man unternehmen könnte gefällt, nämlich die Tourenanbieter, gefühlte 100 Stück an der Zahl. Mit einem X-beliebigen traten wir in die Verhandlungen ein und einigten uns nach zähen Verhandlungen auf einen Preis von 70 US-Dollar für eine 6-7 stündige Fahrt ins Innere der Insel mit Tempelbesch, Reisfeldern und den Besuch des Künstlerdorfes Ubud.
Wir hatten vor 20 Jahren im Rahmen einer Rundreise in Südostasien auf der „Insel der Götter“ eine Woche Badeaufenthalt und die weitläufigen und großen Reisterrassen mitten im Gebirge, die wir während eines Ausflugs zu sehen bekamen, hatten uns unheimlich gefallen und beeindruckt. Deshalb legten wir so großen Wert auf die Reisterrassen und wollten nicht zum Affenwald (Monkey Forest) und zur Schmetterlingsfarm, die uns der Fahrer wie „sauer Bier“ als Ziel und Highlight anbot. Nachdem das alles endlich geklärt war, konnte es in einem komfortablen Minivan losgehen.
Der Verkehr war mörderisch und wir brauchten fast 2 Stunden für die 20 Kilometer bis zum ersten Ziel, die Tempelanlage Kunjungan in der Ortschaft Batuan. Diese Anlage ist eine von vielen Dutzenden, die wirklich überall auf der Insel zu finden sind. Aber einige „auserwählte“ Anlagen werden von den Taxen und Ausflugsbussen verstärkt angefahren.
Zu unserem nächsten Ziel, dem Künstlerdorf Ubud musste sich unserer Fahrer weiter durchkämpfen, umschwirrt von unzähligen Mopeds, die links und rechts überholen. Die Fahrer entweder barfuß oder mit Flipflops an den Füßen. Sicherheitsabstand ist hier übrigens ein Fremdwort, jeder verfügbare Raum wird ausgefüllt. Dadurch gelingt es den Fahrzeugen, die aus Seitenstraßen kommen, sich in den scheinbar endlosen und lückenlosen Strom in der Hauptstraße irgendwie einzufädeln.
Das Künstlerdorf Ubud ist gar kein Dorf mehr, sondern eine lebhafte Stadt. Von Boheme und alternativem Leben, das einmal das Besondere dieses Orts war, ist nichts mehr geblieben. Es wimmelt vor Touristen. Von der Hauptverkehrsstraße aus, wo uns der Fahrer abgesetzt hatte, war auch eine Reisterrasse zu sehen. Aber hier pflügte nicht ein einsamer Reisbauer mit einem Ochsengespann den Boden, sondern es tummelt sich unzählige Touristen auf den Wegen zwischen den einzelnen Terrassen.

Doch bei geschickter Wahl des Bildausschnitts sieht die Sache schon besser aus. Man müsste nur noch die Touristen wegretuschieren.
Irgendwie hatten wir uns das Wiedersehen mit Bali anders vorgestellt. Aber das Bali, das wir in unseren Köpfen hatten, gibt es wohl nicht mehr. Der Fahrer wollte uns mit einem Abstecher zu einer Kaffeeplantage trösten, aber wir verzichteten.
So fuhren wir also wieder zurück zum Schiff, mit einem kleinen Abstecher nach Denpasar, der Hauptstadt von Bali.
Auf der gesamten Strecke ging eine Ortschaft in die nächste über, es gab so gut wie keine freien Flächen mit Feldern oder Wiesen zu sehen. An der Straße reihte sich Geschäft an Geschäft und kleine Handwerks- und Gewerbebetriebe aneinander. Wohngebäude gab es an der Straße so gut wie keine, die lagen in der Regel den Seitensträßchen.
Dieser Ausflug war zwar nicht das, was wir erwartet hatten, aber er war deswegen nicht uninteressant und reizlos. Überall, auch an der Hauptstraße, findet man kleinere und größere Opferaltäre und immer wieder Tempel und Plätze für religiöse Zeromonien , wo auch hier die Leute ihre kleinen Opfergaben ablegen; Blüten und Kräuter, ein Stückchen Obst, aber auch gerne mal eine halben Zigarette oder ein Bonbon als Zugabe.
Die allgegenwärtigen Steinfiguren, Skulpturen, die Architektur der Mauern in dem typisch balinesischen Stil sorgen für ein Flair, das eben nur in Bali zu finden ist.
100. Reisetag - Donnerstag, 30.03.2017 Benoa/Bali/Indonesien
Wir wollten es heute noch einmal versuchen, das Bali zu finden, das wir in den Köpfen hatten und diese Erinnerung bestand nun mal aus eindrucksvollen Reisterrassen, eingebettet in die Natur.
Gleich am Eingang des Hafenterminals, noch vor der Apparatur, mit der jedes Mal unsere Rucksäcke durchleuchtet wurden, saß an einem Schreibtisch ein offiziell aussehender Herr und fragte nach unseren Plänen. Er könnte uns fahren, egal wohin. Egal wohin war dann doch etwas kompliziert, denn er empfahl uns immer wieder die Route, die wir schon gestern absolviert hatten. Es war schwierig, dem Betonkopf klar zu machen, was wir wollten und man war sich irgendwann dann doch noch einig. Nur stellte sich jetzt heraus, dass nicht er, sondern ein guter Bekannter uns fahren würde und unser Verhandlungspartner griff zum Telefon. In 10 Minuten wäre der Fahrer da. Wir machten deutlich, dass wir nicht ewig warten würden. Nach gaben 20 Minuten Warten gaben wir auf und trotz größter Beteuerungen, dass es gleich losginge, sagten wir die Tour wieder ab. Wir kannten ja den mittlerweile den örtlichen Verkehr und wer weiß, woher der gute Bekannte angereist kam.
Nach der Rucksackkontrolle gingen die Verhandlungen mit einem der vielen wartenden Fahrer erneut los. Und da anscheinend die Wunsch des Fahrgastes, wohin er fahren möchte, auch nur von untergeordneter Bedeutung war, dauerte das Palaver wieder volle 10 Minuten, bis wir halbwegs unseren Willen durchgesetzt hatten, indem wir ständig folgende Begriffe gebetsmühlenartig wiederholten: country side, rice terrasses, nature, no tourists, no traffic, not Ubud. Die anschließende Preisverhandlung ging dann doch relativ schnell von statten. Von ursprünglich geforderten 150 Dollar traf man sich dann bei 80 Dollar.
Natürlich mussten wir erstmal aus dem Moloch rund um Denpasar heraus und tatsächlich wurde es nach 2 Stunden ländlicher. Man kam durch kleine Dörfer und fuhr an landwirtschaftlich genutzten Flächen vorbei.
Heute war auch ein besonderer religiöser Tag, in den Straßen standen vor jedem Haus in gelbe Tücher gehüllte „Gestelle“ (mir ist keine passendere Bezeichnung dafür eingefallen), mit einem gelben Schirmen verziert und vor den Tempeln wurden von Balinesen in traditioneller Kleidung für uns fremde Zeremonien und Prozessionen vorbereitet.
Natürlich kamen wir auch an Reisfeldern vorbei und legten an einem Feld einen Fotostop ein.

Dann begann der Anstieg in das vor uns liegende Gebirge und wir bekamen endlich die Landschaft zu sehen, die wir sehen wollten, einschließlich Reisterrassen.
Weiter ging es ins Gebirge bis auf 1200 Meter zur Tempelanlage Pura Bratan an einem Vulkansee gelegen. Während der Fahrt dorthin begann es zu regnen.
Natürlich ließ es sich nicht vermeiden an diesem Ort auf weitere Touristen zu treffen, aber das war in der Weitläufigkeit der Anlage mit den verschiedenen Pagoden, Pavillons und Parkanlagen nicht besonders störend und man lebt nun mal nicht alleine auf der Welt, es gibt noch Japaner, Chinesen und Australier.
Was tatsächlich störte, war der Regen und zu allem Überfluss hatte Doris auch noch ihren Schirm vergessen. Das Schirmproblem war schnell gelöst. Mehrere Schirmverleiher boten einen großen stabilen Regenschirm für umgerechnet 70 Cent Leihgebühr an. Der Vorgang ruhte auf dem Prinzip Vertrauen, es wurde weder eine Kaution noch ein Pfandgeld verlangt.
Unbeeindruckt von den Touristen feierten die Balinesen in dieser Traumkulisse ihren gelben“ Feiertag“ mit Prozessionen und Gamelanmusik, eine für uns Europäer vollkommene geheimnisvolle und unverständliche Welt.

Ein Gamelan-Orchester besteht aus verschieden eigentümlichen Xylophonen (wie hier im Bild), Klangschalen und Rhythmusinstrumenten. Sowohl das gesamte Klanggebilde auch die Melodien sind für das westliche Ohr sehr fremdartig.
Hier hätte man gut noch länger bleiben, am See entlang spazieren gehen und sich alles genauer ansehen können. Aber es goss nach wie vor aus Kübeln, dass wir es vorzogen, wieder zurück zu fahren.

Der nächste religiöse Feiertag ist nächste Woche. Hierfür werden diese aus dünnen Holzspäne gefertigten "Deko-Artikel". Unser Fahrer hat unterwegs auch einige davon gekauft,"wegen Zeromonie", wie er uns erklärte.
Am Hafenterminal befindet ein kleiner Markt, aus einfachen Brettern und Planen zusammengebastelten Buden. Vor einem kleinen Laden standen 3 Tische mit Stühlen und ein Kühlschrank mit Getränken. Hier trank ich erstmal eine kleine Flasche Bier (Marke Bintang). Zechkumpane hatte ich hier auch schon. Ich war gestern Abend auch schon mal hier, um ein Fläschchen des recht gut schmeckenden Bintag-Biers zu trinken und man hatte sich in völkerverbindender Freundschaft zugeprostet und ein paar Worte gewechselt. Und die Proster von gestern Abend waren heute am späten Nachmittag auch wieder da. Nur heute tranken sie Wasser, sie mussten noch Auto fahren..
Ich kam auf die Idee, meine balinesischen mit dem Sekt zu beglücken, der sich seit Reisebeginn in unsere Kabine angesammelt hatte. 1 x Begrüßungssekt, 1 Bingo-Gewinn, 2 x Geburtstagssekt, diese Flaschen könnte man so vielleicht sinnvoll entsorgen. Gesagt - getan. Zurück aufs Schiff, 4 Flaschen Sekt in den Rucksack und zurück an Land. Da gab es aber noch die Rucksackkontrolle und ich musste lernen, dass man nur eine Flasche an Land bringen dürfe. Der Mann am Durchleuchtungsgerät forderte mich auf, die Flaschen zum Schiff zurückzubringen. Ich war kurz versucht, ihn mit einer Flasche zu bestechen. Da ich aber grundsätzlich gegen Bestechung und krumme Geschäfte bin, bat ich lediglich, die überzähligen drei Flaschen bei ihm deponieren zu dürfen, damit ich sie auf dem Rückweg mitnehmen kann. Mit dieser Regelung war der „Zöllner“ einverstanden.
Mit nur einer Flasche Sekt kam ich bei meinen wasserzechenden Freunden an, die den Sekt gerne mit großem Hallo entgegen nahmen. Der „Sprecher“ des Trüppchens, das war derjenige, der am besten englisch sprach, verstaute sie erst mal in dem bereits erwähnten Kühlschrank. Und da er schon als Bartender auf einem Kreuzfahrtschiff gearbeitet hat, wusste er auch von den Tücken eines unter Druck stehenden Sektkorkens, wie er uns und seinen Kollegen berichtete.
Ich hatte auch noch eine Plastikdose voll mit Schokoladentäfelchen und Schokoherzen mitgebracht. Wir bekommen jeden Abend zwei dieser Leckerlies als Betthupferl auf die Kabine, da hat sich nach 100 Tagen so einiges angesammelt. Es war kein Problem, die Süßigkeiten loszuwerden.
Auf dem Rückweg sammelte ich bei der Gepäckkontrolle meine 3 F laschen wieder ein und fragte jetzt den Kontrolleur, ob er eine Flasche haben möchte. Hocherfreut wollte er.
Und schon wieder ist eine Reiseetappe zu ende. Die 6 und damit vorletzte Etappe beginnt und nennt sich „Exotik pur zwischen Bali und Dubai“.
Schön, dass wir noch nicht von Bord müssen.
101. Reisetag - Freitag, 31.03.2017 Benoa/Bali/Indonesien

Was die abgereisten Gäste gestern in den Kabinen zurückgelassen hatten, hatte heute die Müllabfuhr abgeholt. Die Säcke wurden von den Müllleuten nach brauchbaren Sachen wie T-Shirts, Jeans etc. durchsucht.
Nachdem wir ja gestern „unser“ Bali gefunden hatte, konnten wir es heute locker angehen. Mit einem anderen Ehepaar wollten wir eine „Fahrgemeinschaft“ bilden, um an den Strand in das 10 Kilometer entfernte Kuta zu fahren. Diese hatten gestern schon „ihrem“ Taxifahrer in Aussicht gestellt, heute wieder mit ihm zu fahren. Mit ihm handelten sie jetzt den Fahrpreis für Hin- und Rückfahrt nach Kuta aus. Zu dieser Verhandlung gesellte sich einer meiner Kneipenbekanntschaften von vorgestern und gestern dazu. Er war auch Taxifahrer und man sah ihm die Enttäuschung an, dass wir nicht mit ihm verhandelten, sagte aber immer wieder, dass es OK sei und wir verabschiedeten uns schließlich mit Handschlag.
Der mittlerweile ausgehandelte Fahrpreis betrug stolze 30 Dollar, aber auf vier Köpfe verteilt ist es gar nicht mehr so viel, trösteten wir uns.
Kuta ist der „Ballermann“ von Bali, aber dort, wo der Fahrer meinte, uns rauszulassen, war es ruhiger, keine Karaoke-Kneipen und Bars, sondern nur ein unspektakulärer Strand mit einigen Surfern und jeder Menge Strandverkäufern, die an ihren provisorischen Ständen und Tischen Obst, Snacks und Getränke verkauften.
Die feinen Ressorts, die direkt am Meer liegen und auch das Vergnügungsviertel waren wohl woanders.
Der Strand war nicht besonders sauber, aber da wir nicht baden wollten, sondern nur mit den Füßen ein wenig ins Wasser, war auch das nicht weiter tragisch.
Nicht weiter verwunderlich war, dass sich auch hier am Strand ein Tempel befand.
Der Strand und die vielbefahrene Uferstraße waren durch eine Mauer, natürlich im balinesischen Tempelstil, voneinander getrennt und alle 100 Meter ein Tor, um den Strand zu betreten bzw. zu verlassen.
Wir machten noch einen kurzen Abstecher ins Sharaton Hotel, das sich auf der gegenüberliegenden Seite der Uferstraße befand, um mal neugierig zu schauen, wie sich ein Ressort an so einer nicht besonders attraktiven Stelle gibt.
Es war natürlich alles sehr elegant und gediegen und die Terrasse mit Pool an der Straßenseite war so geschickt angelegt, dass man Straße und Verkehr nicht sah, sondern der Blickwinkel so war, dass man erst hinter die Strandmauer blickte und dadurch nur Sand und Wasser sah und keine Autos und Mopeds.

Service des Sheraton Hotels. Im Foyer wird man von dieser Dame freundlich begrüßt. So in etwa sehen die Tänzerinnen der traditionellen balinesischen Tänze aus
Selbstverständlich mussten wir auch in einem der vielen Shops noch etwas kaufen, in unserem Fall leichte und buntgemusterte Baumwollhosen.
Da waren auch die drei Stunden schon vorbei, die Zeit wo uns unser Fahrer abholen sollte, was er auch zuverlässig getan hat.
Um 15.00 Uhr legte die Artania ab, es gab wieder Sekt am Außenheck an der Phoenix -Bar Um 17.00 Uhr mussten wir alle wieder zur Rettungsübung, sowohl die Neuankömmlinge von gestern als auch so alte Hasen wir.
102. Reisetag - Samstag, 01.04.2017 Surabaya/Java/Indonesien
Java liegt in direkter westlicher Nachbarschaft von Bali und gehört zur Inselgruppe der „Großen Sundainseln“.
Surabaya mit 2,8 Millionen Einwohnern die zweitgrößte Stadt Indonesiens hinter der Hauptstadt Jakarta.
Gegen 10.30 Uhr legten wir an. Begrüßt wurden wir von einer Tanzgruppe. Um diese Tänze richtig zu verstehen, braucht es allerdings Kenntnisse der Mythen und Sagen, die hierbei dargestellt werden. Für den Kreuzfahrer mit seinen kurzen Aufenthalten ein unmögliches Unterfangen.
Nach dem Mittagessen zogen wir los, ohne genau zu wissen, was wir eigentlich unternehmen wollten. An der Touristinformation im Hafengebäude erhielten wir einen Stadtplan und den Vorschlag zum 5 Kilometer entfernten Heldendenkmal „Tugu Pahlawan“ zu fahren. Dort würde sich auch die Altstadt befinden.
Unsere erste Verhandlung mit einem Tourenanbieter scheiterte, weil er 30 Dollar für Hin- und Rückfahrt wollte, wobei man sich auch schon gleich für den Rückfahrzeitpunkt entscheiden hätte müssen. Deshalb nahmen wir ein normales Taxi, dessen Taxometer bei der Ankunft am Denkmal etwa 30.000 Rupiah anzeigte, das sind umgerechnet 2,10 €.
Wir hatten gehofft, dass an einem so zentralen Platz auch immer Taxis stünden, dem war aber nicht so. Plan und Konzept, wie man zum Hafen zurückkommt, wurde erst mal auf später vertagt.
Auf dem Heldenplatz, vor einem hohen Obelisk, wurde eine Schulklasse fotografiert.,Da fotografierten wir doch gleich erst mal mit.
Als wir gerade weiter ziehen wollte, kam ein junger Mann kam auf uns zu und bat, ihn zu fotografieren. Es stellte sich schnell heraus, dass wir auch mit auf das Foto sollten. Technisch war das dadurch möglich, dass er eine kleine Kamera über ein Kabel mit seinem Smartphone verbunden hatte und das Smartphone sowohl als Display als auch als Auslöser fungierte. Sein Arm diente dabei als Selfiestnick.
Dann begann er zu erklären, dass das Denkmal zu Ehren der getöteten Widerstandskämpfer errichtet wurde, die 1945 nach Ende des 2. Weltkriegs sich gegen 3 Besatzungsmächte wehrten, nämlich die Japaner, die Niederländer und die Engländer.
Ich ging davon aus, dass wir jetzt einen kostenpflichten Stadtführer an der Backe hatte, aber das war ein Irrtum, er war einfach nur ein wenig neugierig auf uns exotische Europäer.
Er gehörte irgendwie zu der Schulklasse, die fotografiert wurde, ob Lehrer, Hausmeister oder was auch immer, das blieb im Dunklen. Die Schüler gehörten zu einer Abschlussklasse der „Primary Highschool“ und die Fotos wurden für ein „Memorybook“ angefertigt.

Das Corporate-Design dieser indonesischen Bank in Surabaya erinnert doch sehr stark an unsere gute alte Volksbank ...
Als wir ohne bestimmtes Ziel weiterzogen, stellten wir fest, dass unser Stadtplan nicht viel taugte, selbst sehr breite Straßen, die wir überquerten, waren auf dem Plan nicht zu finden. Deshalb wollten wir erst einfach einmal einfach um einen Block laufen, (so verliert man die Orientierung nicht), ohne große Hoffnung etwas Interessantes zu sehen.
In der kleinen Straße, in die wir eingebogen waren, gab es einige kleine Läden, in denen ein Sammelsurium an technischen Geräten verkauft wurden. Als ich mir interessiert ein Schaufenster mit Manometern betrachtete, wurden wir eingeladen in den Laden zu kommen.

Falls jemand mal einen Druckmesser braucht. Der Laden befindet sich genau gegenüber dem nicht viel größeren Lädchen, in dessen Auslage man Baggerschaufeln und Antriebsketten findet. :-)
Obwohl ich keinerlei Absichten hatte mir ein Druckmessgerät anzuschaffen, betraten wir den kleinen Laden. Wir wurden gefragt woher wir kommen, was wir hier machen und so weiter. Als ich fragte, ob ich Fotos machen dürfe, rannte ich offene Türen ein. Man bot uns auch an, etwas zu trinken. Zaghaft sagten wir zu, aber unsere Angst irgendetwas zu bekommen, was wir nicht vertragen, war unbegründet. Wir bekamen jeder einen Becher Mineralwasser, der, wie bei uns die Jogurtbecher, mit einem Foliendeckel versiegelt war.
Wo wir auftauchen, werden wir meist ein wenig bestaunt und zeigt man ein kleines Lächeln, wird das sofort überschwänglich erwidert. Und immer wieder werden wir auf von den Leuten aufgefordert Fotos zu machen. Die Fotografieritis ist hier wohl eine „Volkskrankheit“.

Dieser coole Typ wollte unbedingt mal meine Sonnenhutaufsetzen und fotografiert werden. Ich muss zugeben, er steht ihm weitaus besser als mir. Dennoch musste ich drauf bestehen, dass er ihn mir wieder aushändigt.
In einer anderen Seitenstraße fielen uns die vielen Pflanzkübel mit Grünpflanzen vor den kleinen Wohnhäusern ins Auge, was sehr hübsch aussah. Wie wir unschlüssig davorstehen in das Gässchen einzubiegen oder nicht, werden wir auch schon freundlich aufgefordert, uns die Sache anzuschauen. Drei junge Männer begleiten uns. Allerdings klappt die Verständigung nicht sehr gut, also wird ein weiterer junger Mann herbeigeholt, der ein paar Brocken Englisch kann. Kurze Zeit später trifft zu unserem Grüppchen noch eine junge Studentin hinzu, die perfektes Englisch spricht und nun die Führung übernimmt.
Wir befinden uns im „Kampung Lawas Maspati“, einem Dorf mitten in der Großstadt, unsere junge Führerin spricht hierbei von einer „Community“. Das Dorf besteht aus 4 parallelen Sträßchen und ist wohl so eine Art Vorzeigeobjekt, das von der Stadt und einigen lokalen Firmen finanziell unterstützt wird.

Drei unserer Führer durch Kampung Lawas Maspati. Leider haben wir gar kein Foto, auf dem die nette junge Studentin zu sehen ist.
Neben den Häusern neuern Datums gibt es auch einige historische Häuser, deren Geschichten in einer kleinen Broschüre, die man uns gegeben hatte, beschrieben sind.
Von einer älteren Dame wurden wir in ihr Haus ins Wohnzimmer eingeladen, um etwas zu trinken und ein paar Plätzchen zu essen. Das Wasser, das man uns anbot, war das Gleiche wie schon in dem Geschäft vorher, also völlig unbedenklich.
Am Ende der kleinen Führung gab man uns die Gelegenheit (ohne jede Aufdringlichkeit) aus einer winzigen Auswahl von kleinen Souvenirs und T-Shirts, etwas zu kaufen. Wir entschieden uns für eine hölzerne Rumbarassel (für umgerechnet 1,50 €). Unsere Frage, ob es eine Gemeinschaftskasse gäbe und ob wir dieser etwas spenden dürften, wurde mit einem freudigen Ja beantwortet.
Jetzt war es auch schon wieder an der Zeit, sich wieder zurück zum Schiff zu bewegen und tatsächlich gelang es uns während einer Ampel-Rotphase ein Taxi in der dritten Reihe des chaotischen Verkehrs „einzufangen“, einzusteigen und zum Hafen zurückzufahren.
Bevor wir endgültig zum Schiff gelangten, galt es noch eine kleine Irritation aus dem Weg zu räumen. An der Zufahrt zum Hafengelände gibt es eine Schranke und ein Häuschen mit einem „Schrankenwärter“. Dieser versuchte von uns eine Einfahrtgebühr zu erheben. Aber ein kurzes, aber bestimmtes „No“ von uns genügte, um diesen Versuch abzubrechen.
Der Abschied aus Surabaya war schon sehr imposant. bereits 2 Stunden vor der Abfahrt war die Besucherplattform des Terminals voller Menschen, die das Auslaufen der Artania beobachten wollten.
Allerdings verzögerte sich die planmäßige Abfahrt noch etwas. Es fehlten noch einige Ausflugsbusse, die im Verkehr stecken geblieben waren und dann ließ sich auch noch der Lotse mit seinem Erscheinen etwas Zeit. Doch dann hieß es Leinen los und hunderte Menschen winkten uns zu.
103. Reisetag - Sonntag, 02.04.2017 Semarang/Java/Indonesien
Pünktlich um 8.00 Uhr machten wir an der Pier von Semarang fest. Semarang ist mit 1,3 Millionen Einwohner eine weitere indonesische Metropole.
Von Semarang aus macht man in der Regel einen Ausflug zur gigantischen Tempelanlage Borobudur, einem UNESCO Weltkulturerbe. Ich war dort vor 30 Jahren schon einmal gewesen, was Doris veranlasst hatte, auf einem Ausflug mit Phoenix dorthin zu verzichten, zumal ich zu berichten wussten, dass schon damals spätestens ab 10 Uhr morgens der Massentourismus eingesetzt hatte.
Gleich am Hafenterminal gab es auch einen Informationsstand, wo man uns erklärt, dass man am besten mit den „Blue Bird“ Taxen fahren sollte, weil viele andere Taxen oft unseriös arbeiten. Da wir auf unserem Weg vom Schiff durch das Hafenterminal bisher nur von privaten Tourenanbietern angesprochen wurden und auch bei der Suche in der näheren Umgebung keine richtigen Taxis fanden, weder blaue noch andersfarbige, marschierten wir noch einmal zur Information. Dort musste man zugeben, dass es hier am Hafen gar keine Taxen gibt. Also traten wir mit einem der Tourenanbieter in Verhandlung. Es gelang uns schließlich, ihm klar zu machen, dass wir keine Sightseeingtour machen möchten, sondern nur ins Zentrum gebracht werden wollen. Ein weiteres Ehepaar schloss sich unserer Verhandlung an und für 12 US-Dollar wurden wir dann in die City gebracht. Hier trennten sich die Wege von uns und dem Ehepaar, welches während der ganzen Fahrt damit gehadert hatte, dass man den Fahrer auch noch auf 10 Dollar hätte herunterhandeln können.
Gleich wo uns der Fahrer rausgelassen hatte, befand sich eine evangelische Kirche, was für Java, wo mehr als 90% der Bevölkerung dem Islam angehören, etwas Besonderes ist.
Von hier wollten wir uns zum Platz „Simpang Lima“ durchschlagen, wo sich das moderne Semarang mit diversen Einkaufszentren befinden sollte. Wir befanden uns ja noch im alten Stadtteil, dem „Kota Lama“.
Trotz einiger unfreiwilliger Umwege - wir hatten uns mal wieder ein wenig verirrt - kamen wir am „Simpang Lima“ an.
Unterwegs mussten wir immer wieder, wie schon in Surabaya, Fotos mit Einheimischen machen.
Einen längeren Stopp legten wir an einem kleinen Kanal ein. Auf einer Brücke hatte sich schon eine größer Menschenansammlung gebildet und neugierig wie wir sind, gesellten wir uns dazu. Im Kanal schwamm ein größerer Fisch, den Einheimische zu fangen versuchten. Dazu benutzten sie ein völlig verwurschteltes Fischernetz, dass sie erst mühsam und zeitaufwendig entwurschteln mussten. Als sie es schließlich zu Wasser ließen geschah das Unvermeidliche. Alle drei ließen das Netzt los, weil jeder dachte, der andere hält es fest und es landet unter großem Gelächter der Schaulustigen im Kanal. Und da liegt das Netz wohl heute noch, weil niemand den Versuch machte es zu bergen. Somit war die Aktion beendet.

Fahrradrikschas und Handkarren sind auch im 21. Jahrhundert hier immer noch eine Selbstverständlichkeit
Da mittlerweile während unserer Tour durch einheimische Märkte, verkehrsreiche Straßen und kleinen Gässchen und der „Besichtigung“ eines der Einkaufszentren mehrere Stunden vergangen waren machten wir uns auf die Suche nach einem Taxi. Wir fanden zwar keins der empfohlenen Marke „Blue Bird“, sondern ein rotes. Aber zumindest hatte der PKW einen Taxameter und da wir darauf bestanden, wurde er auch eingeschaltet. An der Schranke am Hafengelände, sollten wir wieder „Eintritt“ zahlen und unser Taxifahrer bestärkte uns, dies auch zu tun. Allerdings zeigten wir uns wieder bockig und wollten nicht, also blieb die Schranke erst mal unten. An eine andere, parallel gegenüber befindliche Schranke kam unser Schiffsarzt mit seinem Fahrrad angeradelt und durfte kostenlos passieren. Aber auch dieser Umstand half uns zunächst nicht weiter. Also stiegen wir aus und riefen der Dame am Schrankenhäuschen Worte zu, von denen wir meinten es könnte das Wort „Polizei“ auf Indonesisch bedeuten könnte und siehe da, die Schranke öffnete sich und wir fuhren noch die restlichen 500 Meter bis zum Hafenterminal und zahlten dem Fahrer 30.000 Rupien (2,10 €), die der Taxameter anzeigte. Da der Fahrer anscheinend gemeinsame Sache mit der Schrankenwärterin machen wollte, wurde das Trinkgeld gestrichen.
Auch hier ging es uns nicht um die paar Groschen, die man uns aus der Rippe leiern wollte, sondern um den krummen Weg. Es ist natürlich die Frage, ob man solche kleinen „Schmiergeldzahlungen“ mitmacht, weil das hier einfach so üblich ist oder so etwas grundsätzlich ablehnt. Der geneigte Leser kann das nun selbst be- bzw. verurteilen, und sich überlegen, ob wir nur sture Prinzipienreiter sind oder konsequent gehandelt haben.
104. Reisetag - Montag, 03.04.2017 Seetag
Endlich wieder mal ein Seetag, die letzten 6 Tage bin ich fast nicht zum Schreiben gekommen. Mit Müh‘ und Not habe ich Zeit (und Lust) gefunden, die Fotos ordentlich auf den PC zu überspielen.
Für heute Morgen war eigentlich die Äquatortaufe geplant, aber wegen schlechten Wetters wird die Zeremonie auf den nächsten Tag verschoben. Da die tatsächliche Überquerung des 0. Breitengrads, diesmal von Süd nach Nord, erst heute Nacht gegen zwei Uhr erfolgen wird, wird auch Neptun die Verschiebung akzeptieren.
Am Nachmittag ist Handshake mit dem Kapitän für die in Bali zugestiegenen Gäste angesagt und das Abendessen fungiert unter dem Stichwort Willkommensgala.
105. Reisetag - Dienstag, 04.04.2017 Singapur (Republic of Singapore)
Heute hat die Äquatortaufe geklappt. Obwohl ich nicht dabei war, denn der entsprechende Mummenschanz mit Neptun, seiner Frau und seinen wilden Gesellen ist immer der Selbe (siehe 5. Blogeintrag vom 20.1.2017), egal ab man von Nord nach Süd oder umgekehrt fährt. Eine entsprechende Urkunde haben wir von Phoenix dennoch am Abend in der Kabine vorgefunden.
Um 14.00 Uhr legten wir in Singapur an der Pier am Singapore Cruise Center, nahe
Sentosa Island, an.

Die Strafgelder(engl:. fine) sind hier richtig saftig, nicht wie in Deutschland, wo man mit 10 € aus so einer Nummer 'raus kommt
Um 14.30 Uhr gingen wir von Bord, mussten uns aber im Cruise-Terminal erst einmal einer Gesichtskontrolle bei den Einreisebehörden unterziehen. Außerdem wurden von beiden Daumen die Fingerabdrücke abgenommen.
Der Rucksack wurde durchleuchtet, denn die Einfuhr von Kaugummi ist verboten und auf Drogenbesitz steht die Todesstrafe. Nach gut 20 Minuten war man durch.
Der nächste Tagesordnungspunkt, Geld wechseln, war schnell erledigt, weil im Hafengebäude mehrere Wechselstuben angesiedelt waren.
Auch die U-Bahnstation war schnell gefunden, denn sie befand sich im „Keller“ des Hafengebäudes. Schwieriger allerdings war es, den einzigen Ticketschalter der sehr weitläufigen Station zu finden, denn nur dort konnte man für 16 Singapur-Dollar (ca. 10 €) ein 2-Tages-Ticket kaufen. Alles andere wurde über Automaten abgewickelt.
Um halb vier konnten wir endlich, mit den erworbenen Tickets bewaffnet, die U-Bahn besteigen.
Da dies bereits unser vierter Aufenthalt in Singapur war, hatten wir keine großen Pläne bezüglich Besichtigungsprogramm. Lediglich der Erwerb einer solarbetriebenen chinesischen Winkekatze stand auf unserer Tu-Liste. Deshalb führte uns unser Weg nach Chinatown, wo wir nach langem Suchen in einem der unzähligen Andenkenläden ein passendes, nämlich nicht allzu großes, Exemplar fanden, das sogar bei wenig Lichteinfall immer noch eifrig winkt.
Es ist schon interessant, welche Mengen an geschmacklosen Sachen hier angeboten und auch gekauft wird. Aber anscheinend findet sich für jeden noch so scheußlichen Artikel auch ein Käufer, sogar für Winkekatzen soll es eine Klientel geben.
Wir hatten bereits vor vier Jahren im Reiseblog (https://hoe2013a.wordpress.com/2013/04/23/singapur-und-malaysia/) geschrieben, dass der ursprüngliche Charme des Chinesenviertels von Singapur nicht mehr existent ist. Es gibt sie nicht mehr, die Apotheken mit ihren Wurzeln, Kräutern, mit irgendwelchem getrocknetem und zerriebenem Getier, sie sind nicht mehr da, die kunstfertigen Kaligraphen, die Läden mit völlig unbekannten Produkten und Lebensmittel und die Garküchen mit Speisen, von denen man nicht wissen wollte, woraus sie bestehen.
So gesehen konnten unsere Erwartungen nicht enttäuscht werden
Singapur ist aber nach wie vor eine interessante Stadt, auch wenn das Flair am Singapur River verloren gegangen ist, weil die kleinen und urigen Bars und Restaurants modernen Schicki-Micki-Läden gewichen sind. Aber allein die Architektur der Wolkenkratzer ist einmalig, da haben sich die Architekten richtig was einfallen lassen, unsymmetrische Formen oder kurvige Konturen machen die Skyline außergewöhnlich und einmalig.
Gegen halb acht wollten wir zurück aufs Schiff, aber auch hier werden wir streng kontrolliert. Der Pass wird wieder gescannt, unser Bordausweis kontrolliert und die Daumenabrücke erneut abgenommen. So ist sichergestellt, dass genau der Peter Hölzer wieder an Bord geht, der das Schiff auch am Nachmittag verlassen hat und nicht irgendeine billige Kopie „Made in China“. Dass der Rucksack erneut durchleuchtet wurde, braucht man nicht extra zu erwähnen.
106. Reisetag - Mittwoch, 05.04.2017 Singapur
Für Heute hatten wir sogar einen Plan. Wir wollten auf die Aussichtsplattform des Marina Bay Sands Hotel. Das Hotel wurde 2010 eröffnet, besteht aus drei 190-Meter hohen Türmen, die durch einen 340 Meter langen Dachgarten verbunden sind. Ein kleiner Teil dieses Dachgartens ist für den normalen Touristen zugänglich, der Rest, einschließlich des dort befindlichen Swimmingpools ist den Hotelgästen vorbehalten.
Mit der U-Bahn war man sehr schnell an der Station Bayfront, direkt an besagtem Hotel. Bevor wir Aussichtsplattform, den sogenannten Skypark, in Angriff nahmen, wollten wir uns die „Gardens by the Bay“ ansehen, eine Parkanlage, die 2012 fertiggestellt wurde und bis 2020 weiterentwickelt werden soll.
Die wenigen 100 Meter bis zu einer der Attraktionen im Park, dem Flower Dome, dem größten Gewächshaus der Welt, konnte man wie folgt erreichen:
- zu Fuß gehen,
- einen Shuttlebus nutzen (3 Singapur-Dollar) oder
 mit einem fahrerlosen elektrischen Minibus (5 Singapur-Dollar = 3,30 €) fahren.
mit einem fahrerlosen elektrischen Minibus (5 Singapur-Dollar = 3,30 €) fahren.
Klar, dass wir uns für die innovativste Methode entschieden.
Der kleine Bus fuhr tatsächlich während der ca. 5-minütigen Fahrt ohne Fahrer, aber es war dennoch eine Art Schaffner mit an der Bord, der uns (wir waren die einzigen Fahrgäste) in erster Linie über das Fahrzeug und dessen Technik informierte. Er war bestimmt auch zum Drücken Notaus-Knopfs befähigt, falls diese erforderlich gewesen wäre. Fahrzeug und Fußgänger bewegten sich in friedlicher Koexistenz nebeneinander und so erreichten wir den Flower Dome.

Die Super Trees, ein echter Hingucker in den „Gardens oft the Bay“ Die pflanzenbewachsene Stahlgerüste haben eine Höhen zwischen 25 und 50 Metern. Bis sie völlig zugewachsen sind, dauert es noch ein paar Jährchen.
Den Flowerdom mussten wir aus Zeitmangel unbesichtigt links liegen lasasen und wanderten gemütlich wieder zurück Richtung Marina Bay Sands Hotel, um über eine Brücke zunächst mal in des Innere des Hotels zu gelangten und konnten in einer Höhe von vielleicht 50 Metern einen Blick in das Foyer werfen.
Im Turm Nummer 3 des Hotels wurden die Tickets für die Aussichtsplattform verkauft, stolze 23 S$ (15 €) pro Person kostete der Spaß.
Mit 3-4 Leuten warteten wir gemütlich auf den nächsten Aufzug, als urplötzlich wie ein Heuschreckenschwarm 2 Busladungen mit Phoenix-Ausflüglern einfielen. War es dadurch im Aufzug noch recht eng geworden, bot der Skypark dann doch genügend Fläche, dass man sich aus dem Weg gehen konnte.
Zum Mittagessen fuhren wir nach Chinatown in die Smith Street, die auch als „Food Street“ bezeichnet wird. Der Frankfurter kennt ja in der Mainmetropole die Fressgass‘ und so etwas Ähnliches ist das hier auch. Restaurant an Restaurant und Imbissbude an Imbissbude. Wir kauften uns an solch einer Bude pork, duck and rice (Schweinefleisch, Ente und Reis) und nahmen an einem Tisch an der Straße Platz und ließen es uns Schmecken. Das Tablett mit dem Geschirr konnte man anschließend an einem beliebigen der „Einsammelpunkte“ einem dafür zuständigen Menschen übergeben.

Neben der Artania lag die Superstar Gemini, ein Kreuzfahrer hauptsächlich für asiatische Passagiere. Genau über die Liegeplätze führt die Seilbahn nach Sentosa
Nach dem Mahl fuhren wir wieder zurück zum Schiff. Wir wollten eigentlich noch mit der Seilbahn von der nahegelegen Seilbahnstation rüber zur Insel Sentosa fahren. Die Seilbahn führte nämlich genau über den Liegeplatz der Artania.
Vor 20 Jahren sind wir schon einmal mit dieser Seilbahn gefahren während gleichzeitig im Hafen ein Kreuzfahrtschiff lag. Damals wurde der Wunsch wach, selbst auch einmal mit einem Schiff unter diese Gondelbahn durchzufahren. Dieser Wunsch war ja gestern in Erfüllung gegangen, aber den Plan jetzt über „unser“ Schiff zu gondeln, mussten wir aufgeben, da eine Fahrt nur in Verbindung mit dem Eintritt in den Sentosa-Park, eine Art Disneyland auf der Insel, möglich war. Das war ziemlich teuer und Zeit für den Besuch eines Freizeitparks hatten wir dafür nicht mehr. , Wir mussten nämlich spätestens in 2 Stunden, um 17.00 Uhr auf unserem Dampfer sein, damit dieser um 19.00 Uhr abfahren kann. Zwar genügt es überall auf der Welt eine halbe Stunde vor Abfahrt zum Schiff zu kommen, aber hier kontrollieren die Behörden besonders streng, bevor sie das Schiff zur Abfahrt freigegeben (ausklarieren) und das braucht Zeit
Sicherheit hat seinen Preis, dass muss man einfach akzeptieren.
107. Reisetag - Donnerstag, 06.04.2017 Port Kelang/Malaysia
Port Kelang liegt 40 Kilometer von der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur entfernt. Wir einen Ausflug in die Hauptstadt gebucht, da wir wussten, dass rund um den Hafen sich aber auch rein Garnichts befindet.
es standen zwei Ausflüge zur Auswahl,
- Stadtbesichtigung mit den Petronas Towers und
- Stadtbesichtigung mit dem KL-Tower.
Die Petronas Towers waren mit 452 Metern einmal das höchste der Gebäude der Welt. Der KL-Tower ist ein Fernsehturm, der so aussieht, wie alle Fernsehtürme aussehen und hat eine Höhe von 421 Metern, ist somit nur geringfügig niedriger als die Pertronas Towers.
Da in der Ausflugsbeschreibung zu lesen war, dass bei den Petronas mit langen Wartezeiten zu rechnen ist, entschieden wir uns für (b).
Da mich aber nach dem Aufstehen eine akute Schlafferitis und unspezifisches Unwohlsein überkam (nein es war kein Alkohol im Spiel), musste Doris alleine reisen, auch auf die Gefahr hin, dass die Stornierung genauso viel kostet wie der Ausflug selbst.
Am Rande sei erwähnt, dass ich nach einem vorgezogenen Mittagsschläfchen von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr vollständig wiederhergestellt war.
Gegen 18.00 Uhr war Doris wieder zurück und berichtete, dass der Ausflug ganz OK war, aber dass es bis auf die Türme eigentlich fast nichts gab, was einen bleibenden Eindruck hinterlassen hätte.
Eine Ausnahme sei der Chinesenmarkt gewesen, der hat gefallen. Allerdings wurde den Ausflüglern hierfür nur 20 Minuten zugebilligt, wie das bei organisierten Ausflügen eben ist.
Diese frei Zeit nutze Doris, um mir eine Samsung Powerbank mit einer dollen Kapazität von 12.000 mAh als Mitbringsel zu kaufen - zum Schnäppchenpreis von 10 US-$. In Deutschland kosten diese Akkus von 50 Euro an aufwärts. Klar, dass es sich hierbei um eine Fälschung handelte. Aber dass die Qualität sooo schlecht war. Statt der versprochenen 12.000 mAh schafft das Teil mit Müh und Not vielleicht 200 mAh. Das nächste Mal kaufen wir eben eine Rolex-Uhr für 5 $, da weiß man, was man hat.
108. Reisetag - Freitag, 07.04.2017 George Town/Malaysia
George Town ist die Hauptstadt der Insel Penang und des gleichnamigen Bundesstaats in Malaysia. Die 180.000 Einwohner sind größtenteils chinesischer Abstammung.
Um 8.30 machte die Artania an der Pier fest und um 9.45 Uhr starteten wir unseren Landgang. Im Hafenterminal gab es eine Wechselstube, wo wir ein wenig Geld tauschten (Malayische Ringgit; 10 Ringgit=2,50€).
Da der Hafen sehr zentral, im Stadtteil „Little India“, lag, wollten wir die Gegend ein wenig zu Fuß erkunden und lehnten die unzähligen Angebote der Taxifahrer und Tourenanbieter ab, bzw. gaben ab dem gefühlten 100. Angebot keine Antwort mehr.
Gleich in der ersten Straße, in die wir einbogen, war eine Wechselstube neben der anderen und die tauschten zu viel besseren Kursen. Aber nachdem wir nachgerechnet haben, wie hoch der Verlust bei einem um 5% schlechteren Wechselkurs bei einem Betrag von 20 US-Dollar war, konnten wir uns doch wieder auf unsere eigentlichen touristischen Aufgaben widmen. Als da wären:
- Der indische Tempel
- Die Moschee
- Der chinesische Tempel
Am chinesischen Tempel war unser Besichtigungsplan eigentlich abgearbeitet und wir brauchten neue Ziele. Beim Blick auf den Stadtplan gefiel uns der Eintrag „Bazar Penang. Da wir die Entfernung zum Basar nicht so gut abschätzen konnten, beschlossen wir, mit einer der an jeder Ecke stehenden Fahrradrikschas zu fahren.

Durchschnitts-Asiate ist in der Regel größer als der der Europäer und dementsprechend ist die Kopffreiheit im Fond bemessen.
Bei den bisherigen asiatischen Städten, haben wir Fahrten mit diesen Vehikeln nicht gemacht. Uns widerstrebt es irgendwie, dass im Zeitalter der Technik und Motoren, die meist schlanken bis schmächtigen Fahrer, sich barfuß oder nur mit Flipflops an den Füßen, meist bei großer Hitze, abquälen, ihre Passagiere per Muskelkraft zu befördern.
Anderseits kämpfen und werben sie für jede Fuhre, schließlich müssen sie davon leben.
Da der Himmel heute bewölkt war und sogar ein leichter Nieselregen herunterging, wollten wir uns entgegen unserer sonstigen Gewohnheiten mit einer Rikscha fahren lassen. Der Fahrer verlangte 30 Ringgit (mehr als 7 Euro) und wir handelten auch nicht, um unser schlechtes Gewissen etwas zu beruhigen.
Nach 10 Minuten hatten wir den Markt erreicht. Außer einer Tüte mit kandiertem Ingwer konnten wir nichts von dem reichhaltigen Angebot gebrauchen.

Gegensätzlicher konnte es nicht sein. Erst der traditionelle Markt und dann das hypermoderne Einkaufszentrum
Aus dem leichten Nieselregen war mittlerweile ein heftiger Platzregen geworden und so flüchteten wir in eine große großen Shopping Mall, die gleich in der Nähe der von uns besuchten Markthalle lag.
In der Prangin Mall, so hieß das Einkaufszentrum, stöberten wir ein wenig durch die Läden, und tranken im Starbucks einen Kaffee.
Da es irgendwann aufgehört hatte zu regnen, gingen wir zu Fuß zum Hafen zurück. Unsere restlichen Ringgit tauschten wir gegen thailändische Baht, die wir an morgen gebrauchen können und waren um 16.00 Uhr wieder auf dem Schiff
109. Reisetag - Samstag, 08.04.2017 Phuket/Thailand
Phuket ist nicht nur die bekannte Stadt in Thailand, sondern dieser Name steht auch für die Insel Phuket und die thailändische Provinz Phuket.
Wir machten um 7.00 Uhr an der Pier von Port Ao Makham fest. Bis in die Stadt Phuket sind es 12 Kilometer. Hier im Hafen wurden einige Verkaufszelte aufgestellt, der nächste Ort ist ca. einen Kilometer entfernt.
Die Landgangsinformationen von Phoenix waren auch nicht sehr erhellend. So war zu lesen, dass sich die Tourist-Info in Phuket-City befinden würde, aber wo genau wurde verschwiegen. Auch gab es diesmal statt eines Stadtplans eine Übersichtskarte von der gesamten Inseln, wenig hilfreich für einen Stadtbummel.
Wenn ich gerade am Meckern bin, auch bei anderen Häfen sind die Karten oft lieblos zusammenkopiert. Mal fehlt die Windrose (Wo ist Norden? Das ist nämlich nicht immer oben), mal fehlt der Maßstab, mal fehlt beides. Das passiert genau dann, wenn man nur einen Ausschnitt eines Stadtplans kopiert und diese elementaren Parameter einer Karte nicht mit auf die Kopie kommen. Dabei ist es ein leichtes im Computerzeitalter, diese Infos dennoch auf das Informationsblatt zu bekommen.
Also ließen wir Phuket-City einfach links liegen und fuhren mit 3 anderen Paaren in einem Minibus zum Strand von Kata Beach. Der ausgehandelte Preis betrug für Hin- und Rückfahrt 10 US-Dollar (+ Trinkgeld) pro Person.
Die halbstündige Fahrt führte durch mehrere Ortschaften, so war die Fahrt alles andere als Langweilig.
Der Strand war in Ordnung und für 200 Baht (ca. 5,40€) mieteten wir zwei liegen und einen Sonnenschirm. Nach 3 Stunden holte uns unser Fahrer wieder alle ab, sodass wir um 14.30 wieder am Schiff waren.
Obwohl bis zur Abfahrt noch sehr viel Zeit war, nämlich bis zum anderen Morgen um 5 Uhr, blieben wir auf dem Schiff bzw. im Hafen. Natürlich mussten wir uns noch die Verkaufsstände an der Pier ansehen und kauften zwei buntbedruckte ganz leichte Baumwollhosen.
Es gab auch eine kleine Garküche, aber was dort gebrutzelt und gekocht wurde, war für uns wenig attraktiv. Aber viele von der Crew, meist Filipinos, bekamen leuchtende Augen und nutzen sehr intensiv das kulinarische Angebot.
Die Gelegenheit, uns ins Nachtleben von Phuket zu stürzen, ließen wir ungenutzt, sondern wir verbrachten den Abend gemütlich auf dem Schiff in Harry’s Bar.
Auf dem Achterdeck trat um 21.00 Uhr eine thailändische Folkloregruppe auf. Als ich mich endlich bequemte ein paar Aufnahmen zu machen, war es schon zu spät. Ein einsetzender tropischer Schauer hatte zum Abbruch der Veranstaltung geführt.
Um 5 Uhr in der Frühe legten wir ab, ohne dass ich irgendwas davon bemerkte, ein Zeichen, dass unsere Kabine in einem sehr ruhigen Teil des Schiffs liegt.
110. Reisetag - Sonntag, 09.04.2017 Phi Phi Inseln/Thailand
Von der Insel Phuket zu den Inseln von Phi Phi Islands (Provinz Krabi) ist es nur ein Katzensprung und so warfen wir um 7.30 Uhr vor Do Ko Phi Phi Don den Anker, denn die Pier ist nur für kleinere Fähr- und Ausflugsboote angelegt, sodass wir dorthin tendern mussten.
Die Phi Phi Inseln im Allgemeinen und die Insel Do Ko Phi Phi Don im Besonderen sind touristische Hochburgen in Thailand.
Da wir um 15.00 Uhr schon wieder abfahren sollten, war ab 9.00 Uhr, als die meisten Passagiere mit dem Frühstück fertig waren, der Run auf die Tenderboote groß. Da aber Phoenix hier immer sehr gut ordnet und organisiert, gibt es keine Drängelei, sondern es geht ganz einfach und stressfrei der Reihe nach.
Um 10.00 Uhr waren wir an Land. Es gab unzählige Möglichkeiten mit einem Boot Fahrten zu Nachbarinseln oder schönen Stränden zu machen. Diese Fahrten dauerten aber 3 Stunden und länger, kamen deshalb wegen unserer kurzen Liegezeit (letzter Tender: 14:30 Uhr) für uns nicht in Frage. So auf die letzte Minute zum Schiff zu kommen ist nicht unser Ding.

Der Strand fest in der Hand von Phoenix.
Meine Phoenix-Tasche habe übrigens mit Geschenkband und farbigen Klebeband gekennzeichnet, damit ich sie besser erkennen kann.
Wenige Gehminuten von der Pier gab es aber einen Strand, zu dem wir uns hinbegaben. Allerdings waren dort schon alle Liegen und Sonnenschirme von Phoenix-Gästen in Beschlag genommen und auch die Schattenplätzen unter Bäumen des schmalen Strands waren bereits Hoheitsgebiet von Inhabern der immer wieder gern genutzten türkisfarbenen Phoenix-Taschen und der blauen Badetücher, die man sich vor dem Besteigen des Tenders aus einer bereitgestellten Kiste nehmen kann.
Dass wir keinen Strandplatz mehr wegen der Phoenix-Invasion fanden, war nicht weiter tragisch, denn dort wo der Sand aufhörte, reihten sich einige einfache Strandbars, wo man an Tischen mit Sonnenschirmen etwas trinken konnte.
Von unserem Vorhaben auch ein wenig im Meer zu schwimmen, sahen wir allerdings dann doch ab, da sich auf dem Wasser kleine Schaumkrönchen zeigten, zwar kein Beweis, aber immerhin ein Indiz, dass man ungeklärtes Abwasser ins Meer leitet. So betrachteten wir lediglich gemütlich das Strand- und Badetreiben bei einer kühlen Cola

Wegen der Autofreiheit werden Waren, aber auch die Koffer der Ankommenden Gäste mit Handkarren transportiert
Beim Bummel durch die autofreien Gässchen des Ortes mit den Läden, Tattoo- und Massagestudios, Backpacker-Unterkünften, Tourenanbietern für Tauch-, Schnorchel- und Bootstouren und den Restaurants, gab es immer wieder etwas zu entdecken und zu fotografieren.

Erotische Massagen mitten zwischen Imbissbuden und Souvenirläden?
(Übersetzung:Wir werden deine Haut mit unseren Lippen massieren.)

Denkste! Sogenannter Fisch-Spa wird hier offeriert.
(Übersetzung: Doktor Fisch. Verbessert die Blutzirkulation. Mikro-Massage (Anknabbern). Zahnlose Fische entfernen abgestorbene Hautzellen. Die gesunde Haut wird belassen.)
Um 14.00 Uhr waren wir wieder auf dem Schiff. Zwar war das Mittagessen schon vorbei, aber man kann sich jederzeit auf die Kabine oder in einer der Bars Hamburger, Hotdogs, Schnitzel, Sandwiches oder einen Salat bringen lassen. Wir entschieden uns für einen Hamburger, die sind hier sehr gut schmecken ausgezeichnet, besser sogar als manches Menü in den Restaurants.
Pünktlich um 15.00 Uhr legten wir ab. Die Artania kreuzte noch ein wenig zwischen einigen Inselchen der Phi Phi Islands, um den Abschied aus Thailand doch noch ein wenig hinauszuzögern und nahm dann Kurs auf Sri Lanka, das wir nach zwei vollen Seetagen erreichen werden.
111. Reisetag - Montag, 10.04.2017 Seetag
2 Tage auf See, das gibt mir Zeit, den Rückstand bei den noch fehlenden Berichten etwas zu verkleinern.
Der heutige Bericht fällt sehr kurz aus. Am Vormittag gab es wieder dem maritimen Frühschoppen. Selbiger scheint unweigerlich mit einem Galaabend verknüpft zu sein und zwar mit der Mittelgala. Der Galaabend besteht dann aus dem Galadinner (Bekleidungsvorschlag elegant) und einer Show des Artania-Show-Ensembles in der Atlantic-Show-Lounge.
Beim Galadinner stehen meist folgende Menüs zur Auswahl:
- ein Fischgericht, bestehend aus Fisch (logisch!) plus einer Riesengarnele
- irgendetwas vom Rind, z.B. Filet, Steak, od. ähnlichem.
Das Rindfleisch wird im Lido-Selbstbedienungsrestaurant, wo wir immer speisen, an der Essensausgabe englisch, d.h. fast noch lebend, angeboten. Mittlerweile wissen wir aber, dass man sich seine Portion auch noch mal auf einer heißen Platte bis „medium“ oder „well done“ durchbraten lassen kann. Dadurch haben die Galaabende etwas von ihrem Schrecken verloren.
112. Reisetag - Dienstag, 11.04.2017 Seetag
Der Nachmittag dieses Seetages wurde dadurch aufgepeppt, dass in der Kopernikusbar französische Crêpes mit Eis angeboten wurden
Für den späteren Nachmittag wurden dann noch die Gäste mit Gold- und Silberstatus zu einem Sektempfang in die Atlantic-Show-Lounge eingeladen. Diesen Status erhält man durch Buchung einer Balkonkabine (Silber) bzw. einer Suite (Gold).
Für Gäste aus der Holzklasse bleibt dann aber immer noch Harry’s Bar, wo sich Doris und ich ein alkoholfreies Weizenbier vor dem Abendessen schmecken ließen.
113. Reisetag - Mittwoch, 12.04.2017 Hambantota/Sri Lanka
Schon früh um 7.00 Uhr machten wir im Hafen von Hambantota fest. Solch einen Hafen hatten wir auf der gesamten Weltreise noch nicht gesehen. Das Hafenbecken ist sehr groß, an den Piers können bestimmt 10 bis 15 Schiffe gleichzeitig festmachen. Aber außer zwei Containerkränen befindet sich auf dem weitflächigen betonierten Hafengelände absolut nichts. Außer uns lagen dort auch keine weiteren Schiffe. Das Ganze sieht nach einer riesigen Fehlinvestition aus.
Da der nächste Ort 10 Kilometer vom Hafen entfernt lag und wir schon am frühen Nachmittag für einen Ausflug antreten mussten, simulieren wir am Vormittag einfach Seetag.
Der gebuchte Ausflug, der um 12.45 Uhr losging, hatte den Titel „Elefanten im Udawalawe-Nationalpark“. Neben uns hatten noch 160 weitere Passagiere die Idee, auf Safari zu gehen. Mit 4 Bussen fuhren wir in einer guten Stunde zum Nationalpark. Wegen des morgigen tamilischen Neujahrsfestes waren die Straßen relativ leer, sonst hätte die Fahrt fast doppelt so lange gedauert.
Der Udawalawe-Nationalpark ist eine Region, die 1972 zum Naturschutzgebiet erklärt wurde.
Dort angekommen stiegen wir in Geländewagen um, je 6 Leute in einen Jeep. Allein die Phoenix-Truppe belegte knapp 30 Jeeps. Ob solch ein Auto-Korso die Elefanten nicht verschreckt und wir gar keine zu sehen bekommen? Aber das Gelände bestehend aus offenem Grasland und Wäldern ist mit seinen 30.000 Hektar (=300 km2) und den vielen Pisten groß genug, sodass sich die Fahrzeuge rasch verteilten.

Suchbild! Der Fahrer machte ein sogar Foto, auf dem man das Chamäleon sehen kann. Ich sehe auch hier nichts.
Als unser Jeep das erste Mal anhielt, war zwar kein Elefant zu sehen, aber ein Chamäleon, so behauptete zumindest unser Fahrer. Als er fragte, ob wir es gesehen hätten, antworteten wir wahrheitsgemäß, dass wir trotz genauer Lagebeschreibung nichts sahen. Also wiederholte der geduldige Fahrer, dass es sich am unteren Ende dieses Astes befände und deutete auf den Busch. Wir sahen immer noch nichts, denn Chamäleons passen sich ja farblich ihrer Umgebung an. Der Fahrer erklärte uns nochmals die Lage und wir sahen immer noch nichts. Um aus dieser Endlosschleife herauszukommen, beschlossen wir zu lügen und alle im Jeep riefen: "Oh ja, jetzt sehen wir’s.“. Das war das Zeichen für den Fahrer, den Motor wieder anzulassen und weiterzufahren.
Hoffentlich sind die Elefanten besser zu erkennen.
Nach mehreren Stopps bei denen wir etliche Bienenfresser (eine Vogelart), Pfauen, einen Leguan und einen Wasserbüffel zu Gesicht bekamen endeckten wir unseren ersten Elefanten.
Leider lugte nur sein Hinterteil aus dem Gebüsch. Das war aber kein Grund, die Fotoapparate ungenutzt zu lassen, es wurde viel und fleißig fotografiert. Zu Zeiten des 36er-Rollfilms, hätte man es sich bestimmt genauer überlegt, auf den Auslöser zu drücken.

Als das Tier sich dann doch aus dem Gebüsch bequemte und noch ein Junges im Schlepptau hatte, wussten wir, dass sich die Tour schon gelohnt hatte.
Es ist doch etwas anderes ein Tier in freier Wildbahn zu beobachten, als in einem Zoo oder Tierpark.
Die Dickhäuter zogen ganz nahe und ruhig an unserem Jeep vorbei, ohne dass sich ein Wassergraben oder Zaun zwischen dem Beobachter und den Tieren befindet.
Gut 2 Stunden dauerte die Jeep-Safari. Wir bekamen noch etliche Elefanten, teils in kleine Gruppen zu Gesicht. Ber schon allein die Fahrt über die holprigen Pisten war ein Erlebnis. Auf den Plätzen auf der Ladefläche des Jeeps konnte man gut sitzen und vor allem gut sehen. Wir hatten das Glück in der ersten der drei Zweierreihen zu sitzen, sodass wir eine gute Sicht sowohl nach vorn, als auch zu den Seiten hatten.
Wie man sich in dem Gewirr von Wegen und Pisten orientieren kann - ohne Navi und Hinweisschildern oder irgendwelchen markanten Punkten - bleibt mir ein Rätsel. Ein Hoch auf den Orientierungssinn unseres Fahrers. Dieser hat es immer wieder verstanden, so zu fahren, dass man möglichst wenig anderen Fahrzeugen begegnete.
Lediglich zum Schuss, an einem See mit dutzenden von Wasserbüffeln (und einem Krokodil) nahm die Verkehrsdichte wieder deutlich zu.
Volle Punktzahl für diesen tollen Ausflug! Und das Wetter war auch gut. Es blieb bedeckt, sodass die Temperaturen angenehm waren und man nicht so schwitzen musste. Mehr bleibt nicht zu sagen, ich hoffe die Fotos sprechen für sich.
Am Abend hatte man das Problem, von den 150 Elefantenfotos wenigsten 100 zu löschen. Das Löschen der Fotos, auf denen nur der Elefantenhintern zu sehen war, bereitete noch keine Probleme. Aber die anderen! Da tat jeder Klick auf das Papierkorbsymbol doch ein klein wenig weh.
In den Bars gibt es kein alkoholfreies Weizenbier mehr, es ist schlicht und ergreifend ausgegangen. Erst in Dubai soll es wieder Nachschub geben. Bei den derzeitigen Temperaturen von 30 Grad im Schatten bei hoher Luftfeuchtigkeit wäre tagsüber der Umstieg auf "richtiges" Weizenbier keine optimale Lösung.
114. Reisetag - Donnerstag, 13.04.2017 Colombo/Sri Lanka
Um 7.00 Uhr machten wir im Hafen von Colombo fest. Unser Liegeplatz war gut, es waren nur wenige Gehminuten bis zum Hafenausgang. Da hatte es die Queen Mary II, ein 5-Sterneschiff dass hier ebenfalls festgenacht weitaus schlechter, weil sehr weit vom Ausgang entfernt. Normalerweise ist es ja umgekehrt, dass wir nämlich am A… der Welt festmachen. Wir selbst haben 4 Sterne, das behauptet zumindest unser Kreuzfahrdirektor.
Da wir um 14.00 Uhr schon wieder ablegen, durfte man heute nicht allzu lange schlafe. Um 9.00 Uhr hatten wir bereits das Schiff verlassen, für unsere Verhältnisse erstaunlich früh.
Da wir vor vier Jahren auf unserer Kreuzfahrt hier schon einmal 2 Tage gelegen haben und sowohl alle Sehenswürdigkeiten (diverse Tempel, Schlangenbeschwörer und Edelsteinmanufaktur) mit dem Taxi und am zweiten Tag die Innenstadt zu Fuß abgeklappert hatten, konnten wir es heute locker angehen.
Im Reiseführer wurde die Uferpromenade erwähnt, die nicht allzu weit (ca. 3 Kilometer) vom Hafen entfernt ist. Dorthin wollten wir mit einem Tuk-Tuk fahren. Ein Tuk-Tuk ist eine dreirädrige Motorrikscha, vergleichbar mit einem Kabinenroller; die als Taxen fungieren. Das Geräusch des Zweitaktmotors erklärt den Namen Tuk-Tuk.
Nach dem Passieren des Hafenausgangs mangelte es nicht an Angeboten. Vielleicht 40 bis 50 Tuk-Tuks und deren Fahrer warteten auf Fahrgäste, besser bedrängten die potentiellen Fahrgäste und zwar heftig. Ein echter Spießrutenlauf begann, wie es zu erwarten war. Jeder wollte uns eine ein bis zwei-stündige Sightseeing-Tour verkaufen. anfangs für 20 US-$. Der Preis stabilisierte sich 50 Meter weiter auf 10 Dollar.
Von Passagieren, die gerade von einer Tour zurückkamen, erfuhren wir, dass sich am Ende einer Fahrt der Fahrpreis zunächst verdoppelt, weil der Fahrer behauptet, der ausgemachte Betrag ist für eine Person und nicht für die Fahrt mit zwei Personen.
Unser Begehren, nur zur Promenade gefahren zu werden, nahmen die Transportdienstleister zunächst nicht ernst.
Es war mühsam, den Fahrern klar zu machen, dass wir zur nur zur Promenade wollten und sonst nichts, sie wollten uns einfach nicht glauben. Irgendwann war dann doch einem der Fahrer klar, dass wir keine 2-stündige Rundfahrt für 10 Dollar machen sondern dass wir Art und Weise der Fahrt bestimmen. Der Preis tendierte von zunächst 5$ auf schließlich 2$ (unser Angebot). Vom Fahrer ließen wir uns noch einmal explizit versichern, dass dies ein Komplettpreis sei.
Natürlich war die Fahrt immer noch überteuert, denn Einheimische würden hierfür nur ein paar Cent bezahlen, aber das ist schon OK
Der zaghafte Versuch des Fahrers, wir sollten doch eine Rundfahrt machen, scheiterte erwartungsgemäß.
Wegen des heute und morgen stattfinden tamilischen Neujahrsfestes war auch hier wie gestern in Hambantota der Verkehr gering und in wenigen Minuten hatten wir unser Ziel erreicht, das Südende der Promenade am „Galle Face Hotel“, einem Kolonialbau, der zu einem Luxushotel saniert wurde. Wir zahlten den vereinbarten Preis und der Fahrer verabschiedete sich freundlich.
Die Promenade war eine einzige Enttäuschung, wahrlich kein Schmuckstück, eher trist, viel Beton, wenig Grün. Auch prominierente Einheimische, ein Bild, das wir gerne beobachten, gab es so gut wie keine. Von den vielen Verkaufsbuden waren die meisten geschlossen. War diese Tristesse vielleicht dem Feiertag oder nur der frühen Stunde (es war 10.00 Uhr) geschuldet?
Trotzig marschierten wir zurück Richtung Nord, zum anderen, in Hafennähe gelegenen Ende der Promenade. Beim besten Willen gab es nichts zu sehen oder zu erleben.
Einem alten Mann, der uns entgegenkam uns anbettelte, gaben wir ein paar Dollar und einem Apfel, den ich vom Frühstücksbuffet mitgenommen hatte.
Uns fiel noch eine Tafel am Rohbau eines Hochhauses mit der Aufschrift „China Harbor“ auf. Das deckte sich mit der Information der Phoenix Reiseleitung, dass Chinesische Investoren Sri Lanka mächtig unterwegs sind.
Es war heiß, sehr heiß - und schwül.
Auf halben Weg beschlossen wir, lieber zum Hafen zurückzufahren, anstatt zu laufen.
An der parallel zur Promenade verlaufenden Straße wollten wir ein Tuk-Tuk anhalten. Wir brauchten aber gar nicht aktiv zu werden, denn als wir noch 100 Meter von der Straße entfernt waren, hielt schon eines an. „We will pay 2 Dollars“ sagten wir fest und bestimmt und der Fahrer war damit einverstanden. So fuhren wir zurück zum Hafen.
Typischer Anfängerfehler, den wir gemacht hatten, denn der Fahrpreis von 2$ galt natürlich pro Person, meinte zumindest der Fahrer („2$ each!“). Wir hätten besser vorher betonen sollen, am besten drei- bis viermal, dass unser Preisangebot uns beide einschließt. Unsere Erklärung, dass 2$ mehr als genug seien, beeindruckte ihn nur wenig. Erst wurde er laut, dann wurden wir laut und ließen ihn dann einfach stehen und gingen. Damit war der Fall erledigt.
Es stellt sich jetzt die akademische Frage, wer wen betrogen/übervorteilt hat bzw. betrügen/übervorteilen wollte. Ich sehe das mittlerweile so, dass das Verdoppeln des ausgehandelten Fahrpreises bei Ausländern, die ja alle scheinbar im Geld schwimmen, hier eine übliche, aber keineswegs verwerfliche Methode ist, die machmal klappt und manchmal eben nicht.
Das ist keine Frage der Moral, sondern ein in ihren Augen legitimer Versuch, im täglichen Überlebens- und Konkurrenzkampf, einen Goldesel anzuzapfen, den so etwas sowieso nicht schmerzt. Was ist daran verwerflich?
Dies ist mit unseren westlichen Vorstellungen von Fairness, Worthalten und Vertragstreue natürlich nicht ganz einfach in Einklang zu bringen.
Zwei Welten prallen aufeinander - und so entsteht Ärger.
115. Reisetag - Freitag, 14.04.2017 Kochi/Indien
Um 9.30 Uhr kam der Lotse an Bord, um den Kapitän bei der Einfahrt in den Hafen zu unterstützen.
Kochi ist eine größerer Stadt mit 600.00 Einwohnern an der westlichen Seite der Südspitze Indiens.
Vor dem Landgang stand diesmal ein sogenannter Facecheck, eine Pass- und Visumkontrolle durch indische Behörden an, die hierzu aufs Schiff kamen. Dieser Check ging zum Glück und entgegen der Befürchtungen der Reiseleitung sehr schnell, sodass wir um 11.30 von Bord gehen konnten.
Viele Mitreisende hatten sich gar kein Visum besorgt, weil die Kosten von 135 Euro pro Stück doch recht happig waren und blieben des halb an Bord.
Unsere Visa Waren um 50% preiswerter, da wir sie nicht über den von Phoenix vorgeschlagenen Dienstleister bezogen hatten, sondern sie uns direkt bei der indischen Botschaft in Frankfurt besorgt hatten.
Wir lagen vor 4 Jahren bereits schon einmal in Kochi, damals sogar für volle zwei Tage, sodass wir die wichtigsten touristischen Stellen schon besucht hatten.
So wollten wir uns diesmal in das Abenteuer stürzen und mit einer Fähre in die Altstadt zu fahren, statt mit einem Tuk-Tuk den 5 Kilometer langen Umweg über eine Brücke zu nehmen; Kochi besteht nämlich aus einer Reihe Inseln und Halbinseln.
Aber zuerst mussten wir uns unseren Weg durch die Tuk-Tuk und Taxifahrer kämpfen, um zu den drei- bis vierhundert Metern entfernten Bootsanlegern zu kommen. Dort war aber nichts, weder Mensch noch Fähre. Ein einzelner Tuk-Tuk-Fahrer, der uns nachgefahren war, erklärte, heute sei ein Hindu-Feiertag und da würden hier und heute die Fähre nicht fahren.
Ihm glauben oder eine noch Weile warten?
Kurzum, wir machten dann doch eine Tour mit ihm, nicht ohne ihm einzuschärfen, dass er uns zu keinen Geschäften fahren soll, weder Kunsthandwerk, noch Schmuck, noch Teppiche oder hochwertige Textilien.
Der Preis 5$, bei genauerer Nachfrage 5$ pro Person, für mindestens 3 Stunden war in Ordnung. Die Attraktionen, die er mit uns anfahren wollte, waren dieselben wie schon vor vier Jahren, Wäscherei, Franziskaner Kirche, Hindutempel, Gewürzmarkt, chinesische Fischernetze etc.
Interessanter als die meisten dieser Ziele (man ist irgendwann doch touristisch gesehen satt) war die Fahrt selbst durch kleine Sträßchen, wo es bunt und quirlig zuging.

Eine Reihe dieser Kunstobjekte nahe der Promenade machten auf die Verschmutzung der Meere mit Plastikmüll aufmerksam
Bei einem Stopp an einer Uferpromenade, beschlossen wir, hier etwas herumlaufen wollen. Unser Fahrer konnte solange Pause machen, bis wir wiederkommen.
An dem kleinen Strand und der Promenade selbst brodelte das indische Feiertagsleben. Man ging spazieren, die Frauen in ihren farbenprächtigen Saris, kaufte sich frische Früchte an einem der mobilen Verkaufsständen oder ging mit den Füßen ins Wasser und hatte Spaß, wenn eine große Welle mehr als nur die Füße nass machte.

Obwohl das Shirt dieses jungen Mannes ähnich farbig ist wie die Saris der einheimischen Frauen, ist er dennoch eindeutig als Tourist zu erkennen. Woran mag das liegen?
Sowohl am Strand als auch auf der Promenade selbst waren wir die einzigen Touristen. Das änderte sich allerdings nach einigen hundert Metern. Es gab plötzlich Sonnenbrillen und Kühlschrankmagnete zu kaufen, ein untrügliches Zeichen für touristisches Aufkommen. Kein Wunder, wir näherten uns den berühmten chinesischen Fischernetzen, eine aus langen und schweren Holzbalken bestehende Konstruktion, mit denen vom Ufer aus ein großes Netz ins Wasser gesenkt und wieder angehoben werden kann.
Die Ausflugsbusse von der Artania ließen auch nicht lange auf sich warten und nach einem kurzen Hallo mit einigen Reisebekanntschaften kehrten wir um, zurück zu unserem Tuk-Tuk, nicht ohne zuvor noch einige Fotos von und mit Einheimische zu machen.
Das nächste Ziel sollte ein Spice Market, ein Gewürzmarkt sein. Vor vier Jahren hatte man uns unter diesem Tagesordnungspunkt zu einem kleinen Lädchen gefahren, wo wir dann überteuertes, aber zugegebenermaßen vorzügliches Curry gekauft hatten. Deshalb fragten wir lieber noch mal nach, was uns erwarteten würde und man sicherte uns einen echten Markt mit mehreren Verkaufsständen zu. Daraufhin fuhren wir zu einem Gebäude, wo in früheren Zeiten einmal Ingwer verarbeitet wurde, wie der Tuk-Tuk-Fahrer zu berichten wusste. Den Gewürzmarkt erreichten wir über eine morsche Treppe, die zum Dachboden dieses Gemäuers führte. Dort residierte ein Kaufmann, der viele Sorten Tee, Gewürze und Nüsse in seinem Angebot hatte. Zwar waren hier nicht die zugesicherten verschiedene Stände mit verschiedenen Händlern zu finden, aber doch zumindest drei verschiedene Tische, mit den unterschiedlichsten Sachen.
Man bot uns verschiedene Tees zum Probieren an und wir entschieden uns für einen der recht scharf, aber dennoch schmackhaft war und wie man uns erklärte, gegen alle möglichen Leiden und Wehwehchen helfen würde. Es handelte sich dabei um ein Kräuterextrakt, bei dem ein Teelöffel für 7 Tassen reichen sollte. Somit würde die in einem Plastikbeutel eingeschweißte Menge für 350 Tassen reichen, wie uns der Verkäufer stolz erklärte.
Schau’n wir mal, ob das alles so stimmt. :-)
Jetzt wollten wir wieder zurück zum Schiff. Bevor wir losfuhren, begann der Fahrer um irgendetwas zu bitten, wovon wir lediglich „nur 5 Minuten“, „Giftshop“ (engl. Geschenkeladen) „etwas zu Essen“ und „Plätzchen für seine Kinder kaufen, weil Feiertag ist“ verstanden hatten. Wegen der Vokabel „Giftshop“ läuteten bei uns sämtliche Alarmglocken.
Da wir vereinbart hatten, keine Rundreise durch die diversen Shops zu machen, bestanden wir auf direkter Fahrt zum Hafen. Ein resigniertes: „OK, OK“ des Fahrers war die Reaktion. Als wir dann doch genau vor dem Eingang eine Geschäfts anhielten, in dem wir damals schon mal mehr oder weniger zwangsweise reingeschickt wurden, mussten wir noch mal unser Veto einlegen.
Am Hafen zahlten wir den vereinbarten Preis plus 5$ Trinkgeld. Aber statt eines erfreuten „Thank you“ wurden weitere 5 Dollar erbeten, allerdings nicht gefordert. Und wieder kamen die Kinder, der Feiertag und die Cookies zur Sprache, wobei er mit Dackelblick, Daumen Zeige- und Mittelfinger zum Mund führte, eine internationale Geste für Hunger.
Das brachte mich auf die Idee, ihm anzubieten, unsere restlichen Vorräte an Betthupferln zu übernehmen. Er war nicht abgeneigt. Ich holte die Schokoladentäfelchen aus unserer Kabine. Auch mit der Flasche Sekt, die ja Alkohol enthält, hatte er keine Probleme und nahm sie entgegen. Ein letzter zaghafter Versuch, damit ich doch noch 5 Dollars herausrücke, blieb erfolglos. Aber ich wurde nicht beschimpft, sondern freundlich per Handschlag verabschiedet.
Resümee: Der Spaziergang am Wasser war super, denn hier gab es dauernd etwas zu sehen oder zu bestaunen und es war einfach nur schön.
Um 17.00 legten wir wieder ab. Wir kamen nochmal an der sehr langen Strandpromenade vorbei, an der wir an Nachmittag zumindest einen kleinen Teil abgeschritten hatten. Sie war schwarz vor Menschen. Und da es mittlerweile schon dämmerte, konnte man an den hellen Displays der Smartphones erkennen, dass unzählige Selfies mit der Artania als Hintergrund angefertigt wurden.
116. Reisetag - Samstag, 15.04.2017 Seetag
Am Abend fand die 6. Gästeshow dieser Reise statt, wer will der darf auf die Bühne. Ich wollte weder auf noch vor die Bühne, sondern trank in Harry’s Bar ein Kölsch, denn das "alcfree" Weizen ist ja aus.
In der Kabine war bereits der Osterhase gewesen und. Mal sehen wem wir die beiden großen Schokohasen übereignen werden.
117. Reisetag - Sonntag (Ostersonntag), 16.04.2017 Mumbai (vorm. Bombay)/Indien
Auch in den Restaurants war der Osterhase nicht untätig gewesen. Auf jeden Tisch befand sich ein aus einem Hefezopf geformtes Nest mit allerlei Schokosachen. Außerdem waren überall Nester mit bunten hartgekochten Eiern innerhalb hübscher Dekoration und Osterensembles bereitgestellt, aus denen man sich bedienen konnte. Man hatte sich wirklich Mühe gegeben.
Um 7.00 Uhr machten wir in Mumbai fest und schon bald danach kamen wieder die Behörden an Bord um einen erneuten Facecheck vorzubereiten.
Wir waren diesmal eine der Ersten, die sich kurz nach acht checken ließen, denn wir hatten ja in Mumbai einen Termin.
Bereits von zu Hause aus hatten wir eine private Tour mit Fahrer und Führer gebucht, die am Hafenausgang auf uns warten würden. Und da es egal ist, ob an dieser Tour 1,2,3 oder 4 Leute teilnehmen, hatten wir die Schiffsärztin Dr. Maurer und den 2. Kreuzfahrtdirektor Jörn Hofer eingeladen, mit uns auf Tour zu gehen. Dr. Maurer hatte vor 2 Jahren zusammen mit ihrem Kollegen Dr. Koller auf der Artania Doris‘ gebrochenen Arm wieder zusammengetackert. Dr. Maurer hatte leider Dienst, sodass wir nur zu dritt losmarschierten. Es war wahrscheinlich zum ersten aber auch zum letzten Mal, dass Doris die erste vom ganzen Schiff war, die an Land ging.
Am Hafenausgang stießen wir schnell auf unseren Führer vom Tourenveranstalter „Reality Tours & Travel“ der uns begrüßte und zum Fahrzeug führte. Das Besondere an dieser Tour war, dass sie auch einen längeren Gang durch Dharavi, einen der größten Slums von Bombay, beinhaltete.
Heute am Sonntag spielt halb Mumbai Kricket, gerade da wo Platz ist, z.B. auch in der ruhigen Seitenstraße am Hafen, wo wir unser Fahrzeug bestiegen. Aber auch in öffentlichen Parks und Anlagen wurde jeder Quadratmeter für diesen indischen Nationalsport genutzt, dessen Regeln sich dem Fußball erprobten Zuschauer nicht erschließen.
Unseren ersten Stopp legten wir am bekannten Gateway of India ein,eine Art Triumphbogen am Meer am Ende eines großen Platzes.
Hier strömen In- und Ausländische Touristen gleichermaßen hin. Hier lässt man sich von einem der vielen Fotografen ablichten. Einmal mit dem Gateway im Hintergrund und einmal mit dem Taj Mahal Palace, ein Prunkhotel der Luxusklasse, das 1903 eröffnet wurde.
Nach dem Fotografieren packt der Fotograf aus seinem Rucksack einen kleinen Drucker raus und druckt die Fotos in einer erstaunlich guten Qualität.
Die nächste Station war der prunkvolle Bahnhof Victoria Station, wo an Werktagen 3 Millionen Menschen „umgeschlagen“ werden. Am heutigen Sonntag war es hier aber sehr ruhig.
Weiter ging es zur nahegelegen riesigen „open air “Wäscherei Dhobi Ghat, wo per Hand in Betonbecken die Wäsche der Hotels und Hospitäler von Mumbai gewaschen wird - auch am heutigen Sonntag.
Die Bahnlinien von der Victoria Station, die durch die Stadt laufen, sind durch Mauern abgegrenzt. An diesen Mauern leben viele Obdachlose, meist unter provisorisch angebrachten Planen untern denen ein wenig Hausrat verstaut ist.
Nächster Stopp: Blumenmarkt.
Wenig Blumen, aber Unmengen von Blüten werden hier gehandelt. Aus den Blüten werden Kränze und Girlanden geflochten, die bei religiösen Zeremonien und Hochzeiten zum Einsatz kommen
Bevor wir unseren Gang durch den Slum Dharavi antraten machten wir Rast in einer kleinen modernen sauberen Cafeteria, um einen Kaffee zu trinken und die Toilette zu benutzen. Die Kaffeepreise dort konnten mit denen am Frankfurter Flughafen durchaus mithalten, aber Kaffee und WC waren OK..
Den Dharavi Slum darf man sich nicht als wilde, illegal errichtete Blechhüttenkolonie am Stadtrand vorstellen. Dharavi war nicht immer ein Slum und ist so alt wie das restliche Mumbai und war ursprünglich eine Fischersiedlung. Mit der Trockenlegung von Wasserflächen, verloren die Fischer ihre Existenzgrundlage. Indische Migranten, meist aus dem Norden, die sich im damaligen Bombay Arbeit und bessere Lebensbedingungen erhofften, oft aber nicht fanden, landen hier, sodass aus der ehemaligen Siedlung ein Slumgebiet wurde. Da Mumbai größer und größer geworden ist, liegt Dharavi jetzt zentral mitten in der Stadt.
Heute werden hier große Mengen Plastikmüll gereinigt, geschreddert und eingeschmolzen, allerdings häufig unter gesundheitsschädlichen Arbeitsbedingungen.
Auch haben wir eine Schmelze gesehen, ein kleiner Raum, wo aus Schrott Aluminiumbarren recycelt werden, verbunden mit Rauch und Hitze. Kein schöner Arbeitsplatz.
Auch Lederverarbeitung ist ein wirtschaftliches Standbeinchen. Man versucht zurzeit durch Herstellung exklusiver Lederartikel, wie Taschen und Jacken unter dem Label „Dharavi“ in den Markt zu kommen.

Die Fladen werden getrocknet und sind ein beliebter "Appetizer" (Vorspeise), wie unser Guide zu berichten wusste
Unser Touranbieter REALITY Tour & Travel engagiert sich, um die Bedingen in Dharavi zu verbessern, indem Teile des Gewinns in Bildungsprojekte investiert werden und damit eine gewisse Vertrauensstellung in Dharavi. Auch rekrutieren sich deren Führer, Fahrer und sonstige Beschäftigte aus (ehemaligen) Slumbewohnern.
Vor Betreten des Slums wurden instruiert auf keinen Fall zu fotografieren, damit die Privatsphäre der dort lebenden Menschen geschützt bleibt. Dieses Instruktion ist Teil des sozialen Konzepts von REALITY Tour & Travel .
Als wir schließlich den Slum betraten, wurden wir durch enge (2 Meter breite) und sehr enge Gassen (1 Meter Breite) geführt, schauten in die verschiedenen Werkstädten, in denen auch Maschinen standen, z.B. Schredder, die mehrere Tausend Euro gekostet haben.
Wir klettern über steile Treppen auf ein Dach, um auf ein Meer von Wellblechdächern zu blicken.
Die Wohnungen sind meist um die 25 m2 klein, zwar mit Wasser und Strom, aber in der Regel ohne Toiletten. Es gibt lediglich eine Reihe öffentlicher Toiletten, die die Menschen benutzen können bzw. müssen.
Rund um die Produktionsstätten hat sich ein Gewirr von kleinen Geschäften und Dienstleistern, wie z.B. Friseure und Büglern gebildet. Hier durfte ich mit der Erlaubnis unseres Führers ein paar „random pictures“, also aus der Hüfte geschossene Zufallsbilder machen.
Die anderen Fotos stammen von REALITY Tour & Travel selbst und sind entweder Downloads von deren Homepage oder von Bildern, die sie auf Flickr zur Verfügung stellen.
Wir hatten erwartet, dass unser Weg durch Dharavi von Gestank begleitet wird. Das war aber nicht der Fall!
Die Schätzungen, wie viele Menschen hier, leben schwanken zwischen 350.000 und einer Million. Die jährliche Wirtschaftsleistung liegt bei umgerechnet 750 Millionen bis 1 Milliarde Euro. Das bedeutet pro Kopf ein durchschnittliches Jahreseinkommen zwischen 1000 bis 2000 Euro, also monatlich zwischen 85 und 170 Euro und das bei einer Arbeitszeit von 12 Stunden am Tag bei 6 Tagen in der Woche. Dabei werden die Träger der Säcke mit dem Plastikmüll wahrscheinlich weniger verdienen als die Müllsortierer und die wiederum weniger als die Besitzern der Maschinen, die ja wiederum die Kredite für ihre Anlagen zurückzahlen müssen. So richtig wohlhabend wird hier niemand.
Der Staat mehrere Wohnblocks in der Nähe von Dharavi gebaut, um die Leute zu bewegen dorthin zu ziehen. Sie könnten dort kostenlos wohnen. Aber das Angebot wird nicht angenommen. Die Menschen brauchen, um existieren zu können, die Infrastruktur, die Handwerksbetriebe und die sozialen und geschäftlichen Kontakte, um existieren zu können. Allein in einer schöneren Wohnung haben sie keine Perspektive. Dharavi ist wie ein gigantisches Uhrwerk, unzählige winzige Rädchen greifen irgendwie ineinander und halten das System am laufen.
Nach dem Besuch von Dharavi fragte unser Führer, ob wir irgendwo etwas zu Mittag essen wollten. Das wollten wir lieber nicht. Ich kaufte mir aber an einem Obststand ein paar Minibananen. Die kann man essen, ohne Verdauungsprobleme wegen ungewohntem Essen oder mangelnder Hygiene bei der Zubereitung zu bekommen.
Der Rest des Tages ist schnell erzählt.
Wir wollten am Haus, in dem Mahatma Gandhi eine Zeitlang gelebt und gearbeitet hat und heute ein Museum ist, zumindest kurz anhalten, um ein Foto machen. Als wir gerade einparkten, strömten zwei Busladungen Phoenix-Ausflügler auf das Museum zu. „Gib Gas“ riefen wir unserem Fahrer zu und deshalb fehlt ein Foto in diesem Bericht.
Der Jain-Tempel und ein kleiner Hindutempel lagen auch noch auf der Strecke, aber mit der Zeit wird man doch etwas tempelmüde.
Aber interessant war noch ein besonderes Einfamilienhaus, das uns unser Führer zeigte. Hier wohnt der Besitzer eines großen indischen Mischkonzerns mit seiner Frau und seinen Kindern. Das Gebäude hat 2 Milliarden US-Dollar gekostet, hat geschätzte 20 Stockwerke, mit Kino, Theatersaal und und und … 600 Bediensteten kümmern sich um Haus und Hof.
Ein klassisches Beispiel von Größenwahn und Dekadenz
Den Abschluss unserer Tour bildete der Besuch eines Marktes, wo wir noch etwas Curry und Paprika kauften.
Um halb sechs waren wir auf dem Schiff zurück, doch ziemlich kaputt, aber voller Eindrücke, über die man noch lange nachdachte und grübelte.
118. Reisetag - Montag (Ostermontag), 17.04.2017 Seetag
Heute am Nachmittag um 15.00 Uhr hatten wir einen Termin, genauer einen Fototermin. Es wurde auf dem Außendeck am Bug der Artania ein Gruppenfoto von allen Passagieren angefertigt, die die gesamte Weltreise mitmachen. Der Fotograf befand sich 3 Decks höher, damit auch alle mit aufs Bild kamen.
Da der Wind recht heftig blies, hatte der Kapitän die Fahrt von 16 auf 4 Knoten gedrosselt, damit es die Frisuren nicht allzu sehr zerfledderte.
Allerdings wurden die anderen Passagiere nicht über das frisurschonende Manöver informiert und machten sich so ihre Gedanken, ob wir nicht einen Maschinenschaden haben.
Bereits zum Abendessen war Ostern vorbei, alle Osterdekoration und die Hefezopfnester waren verschwunden. Ich schätze mal, dass es in den 3 Restaurants auf der Artania 200 Tische gibt und damit 200 Hefezopfosternester wahrscheinlich im Müllschlucker das Zeitliche segnen. Und gerade nach dem Besuch in Indien macht einen das sehr nachdenklich.
119. Reisetag - Dienstag, 18.04.2017 Seetag
Den heutigen Seetag hatte ich gut nutzen können, meine Rückstände bezüglich Blogaktualität ein klein wenig aufzuarbeiten.
Allerdings musste ich meine Arbeit um 11.30 Uhr für den Stadel Frühschoppen unterbrechen, denn statt Mittagessen im Restaurant wir zogen heute die zum allgemeinen Frohsinn angebotenen Käsekrainer dem Mittagessen im Restaurant vor.
Dieser sechste und damit vorletzte Reiseabschnitt wird in 2 Tagen zu Ende sein und deshalb war für heute der Abschiedsgalaabend angesetzt.
Das Galaabende ein wenig den Schrecken verloren haben, weil wir die Steaks nicht mehr roh essen müssen, sondern vielmehr für uns noch ein wenig nachgegart werden, hatte ich ja bereits irgendwann mal erwähnt.
Die Abschiedsgala ist sogar ein Grund zur Freude, denn dann gibt es immer zum Latenightsnack um 22.30 Uhr „Currywurst in 3 Schärfen“. Dieser direkte Zusammenhang zwischen Abschiedsgala und Currywurst war mir bis dato noch gar nicht aufgefallen. Man kann doch immer noch etwas dazu lernen.
Wird besagter Latenightsnack normalerweise eher sehr Verhalten genutzt, bildete sich heute sogar eine Warteschlange, in die auch ich mich eingereiht hatte. Doris ist da viel standhafter.
Interessant war auch ein Hinweis im Tagesprogramm, für den morgigen Landgang in Khor Fakkan, eine Stadt in den Vereinigten Arabischen Emiraten und zwar im Emirat Schardscha (engl. Sharjah).
Es war zu lesen:
Sharjah gilt als sehr konservativ. Bitte achten Sie auf angemessene Kleidung:
Knie u. Schultern sollten bedeckt sein; auch an öffentl. Stränden ist entsprechende Kleidung vorgeschrieben!
Was ist entsprechende Badebekleidung, insbesondere bei Herren?
120. Reisetag - Mittwoch, 19.04.2017 Khor Fakkan/Vereinigte Arabische Emirate(Schardscha)
Die Vereinigten Arabischen Emirate (arabisch الإمارات العربية المتحدة), kurz VAE, sind eine Föderation von sieben Emiraten im Südosten der Arabischen Halbinsel in Südwestasien. An der Küste des Persischen Golfes gelegen und mit Zugang zum Golf von Oman, grenzt das Land an Saudi-Arabien und Oman. Es besteht aus den Emiraten Abu Dhabi, Adschman, Dubai, Fudschaira, Ra’s al-Chaima, Schardscha und Umm al-Qaiwain.
Die Hauptstadt der VAE ist Abu Dhabi, als zweitgrößte Stadt des Landes (nach Dubai) auch ein wichtiges Industrie- und Kulturzentrum.
Quelle: Wikipedia
Auf dem heutigen Dienstplan stand „Schwimmen“. Mit zwei weiteren Ehepaaren machten wir uns auf den Weg vom Schiff zum Hafenausgang, um uns dort ein Taxi zu nehmen. Es war schon sehr heiß und der Weg bis zum Hafenausgang betrug bestimmt einen Kilometer, da war man, bepackt mit den Badeutensilien schön ganz schön groggy.
Mit den Taxifahrern wurden wir schnell handelseinig, zu schnell, wie sich noch herausstellen sollte. Für uns 6 Personen brauchten wir 2 Wagen, um uns zu einem Hotel mit Badestrand fahren zu lassen, wobei wir den Preis pro Fahrzeug (mit je 3 Leuten von uns als Fahrgäste) von 25 auf 20 US-Dollar heruntergehandelt hatten.
Ich beobachtete, dass während der Fahrt der Taxameter lief, der, als wir am Ziel ankamen, auf 24 VAE-Dirham (AED) stand, das sind ungefähr 7 US-Dollar. Aber bei unseren Verhandlungen hatten wir nie nach einer Fahrt mit Taxameter gefragt, sondern nur gefragt, was eine Fahrt kosten soll - also selbst Schuld.
Dem Rat des Taxifahrers, den Strandabschnitt neben dem Hotel zu nutzen, weil man da nichts bezahlen muss, folgten wir nicht. Zum einen hatten die Damen keinen Burkini im Gepäck und wir Herren wussten immer noch nicht was „entsprechende Kleidung“ ist, wie von Phoenix angeraten. Und wir wussten, dass an den Hotelstränden die Bekleidungsvorschriften etwas lockerer sind.
Das eigentliche KO-Kriterium für den öffentlichen Strand war aber die Tatsache, dass es dort keinerlei Schatten gab.
Dass wir für die Nutzung der Fazilitäten dieses eher keinen Mittelklassenressorts etwas zahlen mussten, war klar. Aber unsere Hoffnung mit 10 -15 Dollar davonzukommen, zerplatzte jäh, als man uns anbot, für 29 Dollar( ca. 27€) pro Person die Annehmlichkeiten des Hotels zu nutzen. Take ist or leave ist! Also zahlten wir. Dafür wurden gepflegter Strand, Liegen, Sonnenschirme, Handtücher, Umkleidekabinen, Toiletten, Poollandschaft, klimatisierte Lobby, WiFi etc. geboten.
Der Frage, ob man uns für die Rückfahrt Taxen besorgen könne, wurde zwar verneint, aber man würde uns mit Hoteleigenen Fahrzeigen zum Schiff zurückbringen - für 17 $ pro PKW.
Als wir nach ca. 5 Stunden wieder zurück zum Schiff wollten, waren die am Vormittag erwähnten PKWs leider, leider nicht verfügbar. Aber kein Problem, es gab ja noch den hoteleigenen Minibus, der uns als 6er-Gruppe für 60 $ zurückbringen würde. Wir konnten die Sache noch auf 50 $ reduzieren. Aber da war ja die Hinfahrt mit 2x20$ beinahe noch ein Schnäppchen.
Ach ja, neben der Preisgestaltung und Preisentwicklung der hiesigen Transportdienstleister könnte ich ja noch über den Strandaufenthalt selbst ein paar Worte verlieren.
Es war sehr schön, das Wasser sauber, die Brandung friedlich, die Liegen bequem. Die Badebekleidung der Hotelgäste war sehr unterschiedlich, zumindest bei den Damen. Die ausländischen Badegästinnen trugen wie gewohnt Badeanzug oder Bikini, während die einheimischen Frauen wirklich von Kopf bis Fuß vollständig in schwarzes Tuch gehüllt waren (einschließlich Kopftuch oder Kapuze), während deren Göttergatten badehosentechnisch von den sittenlosen Ausländern nicht zu unterscheiden waren.
121. Reisetag - Donnerstag, 20.04.2017 Dubai/Vereinigte Arabische Emirate
Dubai ist die Hauptstadt des gleichnamigen Emirats.
Um die Stadt vom Emirat Dubai zu unterscheiden spricht man auch von Dubai-City. Hier in Dubai-City leben 2,3 Millionen Menschen, das sind 85% der Bewohner des Emirats Dubai.
- Mit einem der Ehepaare (Anne und Wolfgang), mit denen wir gestern auch Schwimmen waren, wollten wir heute eine Sightseeing-Tour machen. Noch im Hafenterminal wurden wir auch angesprochen und nach dem üblichen Gefeilsche wurde folgendes vereinbart.
- Preis 200 $
- Fahrzeug: Klimatisierter Minivan
- Sightseeing: 5 Stunden, dann Ausstieg (Drop Off) an der Dubai Shopping Mall
- Abholung an der Dubai Shopping Mall um 19.00 Uhr und Rücktransport zum Hafen
Unser Verhandlungspartner war nicht der Fahrer. Der kam jetzt hinzu und brachte uns zum Fahrzeug und es ging los
Wir fuhren zunächst ewig auf einer mehrspurigen Straße, wobei sich kilometerweit links und rechts medizinische Zentren und Spezialkliniken abwechselten.
Die vor uns liegende imposante Skyline war kaum zu sehen, da sie vollkommen im Dunst lag, der sich laut unseres Fahrers ab 15.00 Uhr auflösen sollte.
Der erste Halt war nur ein kurzer Fotostopp um irgendeine Moschee abzulichten, um dann zu einer der vielen Shopping Malls zu fahren. Diese entpuppte sich als ein mondänes Kaufhaus, dessen diverse Auslagen, ein Sammelsurium von Kleidung, Schmuck, Uhren und sonstigen Edel-Nippes uns wenig interessierte. Ein Angestellter im Kaftan führte uns herum, ließ uns aber ansonsten in Ruhe. Fotografieren war nicht erlaubt. Man befürchtete, dass Bilder ins Internet geladen werden und diese dann von Fälschern als Vorlage für Plagiate genutzt würden, so zumindest die Begründung, als ich nachfragte.
Nächster Halt am Jumeirah Public Beach, ein Strand ohne jeden Schatten. Außerdem war heute die rote Schwimmverbotsflagge gehisst. Aber wir wollten hier ja auch nicht baden, sondern von hier konnte man das Burj al Arab (deutsch: „Turm der Araber) gut sehen und fotografieren Es ist eines der gigantomanischen Wahrzeichen der Stadt, eines der luxuriösesten und teuersten Hotels der Welt, 321 Meter hoch.
Und weil dieses Gebäude so berühmt ist, fuhren wir noch ein paar Blocks weiter, um es von einer anderen Seite und Perspektive nochmals fotografieren zu können.

Da man die Bahn nicht auf offener Strecke fotografieren konnte, hier ein Bild aus dem Internet
Quelle: http://thedubaitram.com
Unser Fahrer schlug vor, dass wir mit der „Monorail“ nach Atlantis fahren könnten. Denn nur auf der Zugstrecke würde man ganz ausgezeichnet die künstlich in Palmenform aufgeschütteten Inseln, Palm Islands, sehen. Die Fahrt mit der Bahn kostete allerdings umgerechnet 8$ pro Person, erläuterte uns der Fahrer. Ich war zwar der Einzige, der sich dieses Arrangement von Inseln gerne ansehen wollte, aber die anderen taten mir den gefallen und stimmten ebenfalls zu. Also fuhren wir zur Monorailstation „Gateway“, wo unser Fahrer die Tickets besorgte. Wir trabten zum „Bahnsteig“ während der Fahrer schon zur Zielstation „Atlantis Aquaventure“ fuhr, um uns dort wieder einzufangen.
Die Fahrt auf der Trasse führte zwischen fertigen teuer aussehenden Hotels und riesigen Baustellen vorbei und wir erreichten Atlantis, ohne irgendwie die Palmenformation gesehen zu haben.
Hier hatte man eine prima Sicht auf das „Atlantis The Palm“, ein weiterer Hotelkomplex der Superlative mit 22 Etagen und 1200 Zimmern, aber die aus Inseln bestehende Palmenformation war auch von hier nicht zu erkennen.
Wir machten unsere Fotos und begaben uns Richtung Ausgang. Da irgendwo tief in unseren Inneren der Wurm des Misstrauens nagte, fragten wir an einem Ticketschalter, was denn eigentlich unsere Karten von Getway nach Atlantis gekostet haben. Klare Antwort: „ 10 AEDs“, das sind 2,50$, also nicht ganz die 8 Dollar, die uns der Fahrer genannt hatte. Wir beschlossen, diesen „Irrtum“ unseres Fahrers erst am Ende der Tour zur Sprache zu bringen, weil das sicher Wortschwall und Ärger mit sich bringen würde.

So ungefähr wollte ich das Ensemble sehen. Dass solch ein Panorama nur von einem Helikopter aus zu sehen ist, dafür konnte nun unser Fahrer wirklich nichts.
Bildquelle: Internet
Unser Fahrer empfing und freudestrahlend am Ausgang und frage ob es uns gefallen hätte („You are happy?“). Blöd, wenn man nicht das bekommen hat, was man erwartet hatte, deshalb war unsere Happiness ein wenig zurückhaltend. Noch blöder war, dass der Fahrer jetzt gleich die 4x8$ für die Tickets kassieren wollte. So mussten wir ihn jetzt schon auf seinen „Irrtum“ hinweisen. Wir zahlten ihm die 4x10 AEDs in Landeswährung aus, nachdem es jetzt auch noch Diskussionen über den Wechselkurs und den korrekten Rechenweg gab, der beim Ermitteln des Dollarbetrags, ausgehend von 40 AED, angewendet werden muss. Die Stimmung hatte erheblich nachgelassen.
Unser Fahrer machte natürlich weiter seinen Job und schlug vor, uns zu einem Souvenirladen zu fahren. Warum auch nicht. Der Laden entpuppte sich als Schmuck- und Teppichgeschäft, während wir mehr an Kühlschrankmagnete, Baseballkappen und T-Shirts gedacht hatten.
Jetzt wollten wir die Sache selbst in die Hand nehmen und forderten, er solle uns eine schöne Stelle am Dubai Creek fahren, den Fluss, an dem sich auch der alte Teil von Dubai befindet. Gegebenenfalls wäre doch die Grand Mosque (große Moschee) am Ufer des Dubai Creek ein möglicher Haltepunkt.
Doch unserer Fahrer war anderer Meinung. Zum einen wäre die Grand Mosque gar nicht in Dubai, sondern in Abu Dhabi und er würde uns jetzt noch zum Zabeel Palace fahren und dann wäre es 13.00 Uhr und er lässt uns dann an der Dubai Mall raus und holt uns um sieben Uhr wieder ab.
Dass ihm Doris die Grand Mosque mehrmals auf dem Stadtplan (von Dubai) zeigte, war kein sehr stichhaltiges Argument. Er bestand drauf, dass die große Moschee nur in Abu Dhabi zu finden sei.
Der nächste Streitpunkt war, dass er uns um 13 Uhr schon loswerden wollte, obwohl wir bis 14.30 vereinbart hatten, das hatten wir sogar schriftlich. Zwar nicht in der Form „von: 9.30 Uhr bis 14.30 Uhr Sightseeing“, sondern leider nur in der Form „5 Stunden Sightseeing. Startzeit: 9.30 Uhr“. Das gab wieder Gelegenheit, lange zu diskutieren, wie man das denn rechnen muss, um den korrekten Endzeitpunkt zu erhalten.
Nachdem das dann aber doch geklärt war, fuhr er uns missmutig zum Dubai Creek. Hier lagen zwar einige Dhaus, also diese speziellen Holzschiffe am Ufer, aber es waren hier so gut wie keine Menschen auf der Promenade. Irgendwie war es hier langweilig. Wir fragten, ob man nicht in das historische Viertel Bastakiya gehen könne, das müsste doch irgendwo in der Nähe sein. Davon hatte er angeblich noch nie gehört.

Der Zabeel Palace. Auch wenn wir nur bis auf 300 Meter herankamen, es gibt ja einen Zoom an der Kamera.
Wir gaben auf und sagten, er solle uns bei der Dubai Mall absetzen. Aber er hatte sich jetzt in den Kopf gesetzt, uns noch zum Zabeel Palace zu fahren, obwohl wir das eigentlich gar nicht mehr wollten. Das haben wir zwar auch deutlich artikuliert, genutzt hat es uns wenig.
An den Palast kam man gar nicht ganz heran, man musste gebührend Abstand halten und rein kam man schon gar nicht, schließlich residiert und administriert hier die königliche Familie.
Wie hier in den Emiraten Politik gemacht und regiert wird, konnte ich auch mit Hilfe des Internets auf die Schnelle nicht herausfinden. Die Begriffe Emir, Scheich und königliche Familie purzeln hier munter durcheinander. Nur dass die Macht vererbt wird, ist eine gesicherte Erkenntnis. Man braucht sich also erst gar nicht als Emir zu bewerben oder versuchen, sich vom Volk zum Selben wählen zu lassen.
Um viertel nach zwei setzte uns unser Fahrer an der Dubai Mall ab, ohne dass wir uns weiter um die noch fehlende Viertelstunde kümmerten, wir waren des Diskutierens müde.
Die Dubai Mall ist ein Einkaufszentrum, natürlich wieder eines der Superlative. Mit 350.000 Quadratmetern und 1200 Geschäften ist es eines der größten der Welt, Kunsteisbahn mit Olympia- und Eishockeymaßen inklusive.
So eine Mall hat natürlich auch einen „Food Court“, also eine Aneinanderreihung von diversen „Futterstellen“. Italienisch, griechisch, Thai, arabisch, türkisch, libanesisch, Burger King und und und, es gab nichts, was es nicht gab. Wir aßen eine richtig gute Pizza.
So gestärkt schlenderten wir durch die Geschäfte. Alle 1200 haben wir allerdings in der uns verbliebenen Zeit nicht mehr geschafft.
Vor der Mall befindet sich eine weitere Attraktion, die Dubai Fontain.
„Die Show mit 6000 Lichtern und Farbprojektoren der bis zu 275 Meter aufschießenden Wasserfontänen am Burbj Lake sollten sie keineswegs verpassen.“
So war es im Phoenix-Reiseführer zu lesen. Ab 18.00 Uhr findet das Spektakel jede halbe Stunde statt
Einem Geheimtipp folgend, suchten wir ein Restaurant in der Mall auf, von dessen Terrasse im zweiten oder dritten Stock man eine gute Sicht auf die Wasserspiele hat. Wir hatten Glück und bekamen dort einen Platz. Punkt 18.00 Uhr ging es los. Da es noch hell war, spritzten die Fontänen zu einem klassischen Musikstück noch ohne Illumination. Das Spektakulum dauerte knapp 5 Minuten. Beim nächsten Akt legten die Fontänen zu fetziger Musik noch einen Zahn zu, dynamischer und höher, aber immer noch unbeleuchtet, denn es war ja auch immer noch hell. Beim nächsten Mal sollten wir vielleicht erst kommen, wenn es bereits dunkel ist.
Jetzt mussten wir aber zum vereinbarten Platz kommen, wo uns unser Fahrer auch pünktlich abholte und zum Hafen zurückfuhr.
Irgendwie waren wir von Dubai enttäuscht. Das lag natürlich einerseits an der etwas verkorksten Sightseeing-Tour, zum anderen stößt uns dieser allgegenwärtige protzige Gigantismus auf Dauer doch eher ab.
Heute war wieder eine Reiseetappe zu Ende gegangen und eine neue, leider die letzte, hat begonnen. „Arabische Emirate & Oman bis nach Venedig“, so lautet der Titel.
Wir waren jetzt nur noch 650 Passagiere an Bord, was sehr angenehm ist. Phoenix sieht das wahrscheinlich weniger positiv.
122. Reisetag - Freitag, 21.04.2017 Dubai/Vereinigte Arabische Emirate
Heute am zweiten Tag unseres Aufenthaltes in Dubai wollten wir erst gar nicht mehr von Bord gehen. Aber dieser Plan stammte von gestern Abend, nach der Tour der etwas anderen Art. Aber was stört uns unser Geschwätz von gestern.
Gegen 10.00 Uhr sollte uns Taxi zum Naif Souk fahren, einem Markt für Elektronik-Krimskrams.
Dass die Grundgebühr bei einem Taxi, das man im Hafen besteigt mit 20 AED (ca. 5$) viermal höher ist, als wenn man eines irgendwo in der Stadt besteigt (nämlich nur 5 AED) ist normal und ist nicht auf die kreative Tarifgestaltung einzelner Taxler zurückzuführen.
Unser Taxifahrer machte uns aber darauf Aufmerksam, dass heute Freitag sei, der „Sonntag“ in der islamischen Welt und der Markt erst gegen 12.00 Uhr öffnen würde.

Die Abras sind sehr einfache, aber äußerst zweckmäßige Boote. Wegen der fehlenden Reling geht das Ein- und Aussteigen sehr flott.(auf alle Fälle schneller als beim Tendern)
Ein Blick auf den Stadtplan und wir entschieden spontan, dass er uns zur Abra-Station „Al Ghubaiba“ fahren möge. Abras sind kleine, einfache Fährboote, die zwischen den Ufern des Dubai Creek verkehren. (siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/Abra_(Bootstyp))

Die bunten Girlanden waren ein echter Blickfang. Neugierig geworden betraten wir über die Treppe den Laden und haben prompt eine Kleinigkeit gekauft.
Am Zielangekommen, stellten wir erfreut fest, dass unsere Wahl gut war. Hier herrschte quirliges Leben und der „Old Souk“ war nur wenige Meter von der Fährstation entfernt.
Den Souk nahmen wir sofort in Angriff und haben fast nichts gekauft. Lediglich in einem Lädchen für hinduistische Devotionalien, vergleichbar mit einem Andenkenladen in Lourdes, erstanden wir eine Figur, die auf einer Feder sitzt und die man am Armaturenbrett eines Autos befestigen kann. Somit wird nach Ende der Reise unser Wackel-Elvis im Auto Gesellschaft bekommen.
Bei unserem folgenden Spaziergang am Ufer der Dubai Creek kamen wir auch an der Grand Mosque, der großen Mosche vorbei und ich bin ganz sicher, dass entgegen der gestrigen Aussage unseres Fahrers, wir uns noch nicht in Abu Dhabi befanden.
Auch das unserem gestrigen Fahrer absolut unbekannte historisches Viertel „Al Bastakiya“ fanden wir problemlos.
Dieses Viertel ist mittlerweile ein Museums- und Künstlerdorf. Die Häuser sind renoviert und verputzt und machen eigentlich keinen historischen, sondern eher neuzeitlichen Eindruck. Aber wegen des heutigen Freitags sind die meisten Einrichtungen geschlossen.
In einem kleinen Hof entdeckten wir ein Lädchen vor dem 2 Tischen aufgestellt waren und wo man einen Kaffee bekommen konnten. Eine willkommene Gelegenheit bei der Hitze mal eine Pause einzulegen.
So gestärkt wanderten wir zurück zur Fährstation, um für einen VAE-Dirham (ca. 20 Cent) überzusetzen. Unzählige dieser Schiffchen legten pausenlos an und ab
Der Schiffsführer, der von der Mitte des kleinen Bootes selbiges steuert, übernimmt auch das Inkasso. Die Leute, die weiter weg von diesem Steuermann ihren Platz haben, übergeben das Fahrgeld einfach an ihren Sitznachbarn, der es seinerseits weiterreicht, bis es beim Kassier angekommen ist. Eventuelles Wechselgeld kommt auf gleichem Weg zurück. Erstaunlich wie gut, schnell und zuverlässig dieser Zahlungsvorgang funktioniert./p>
Mit ca. 20 Passagieren ist das Boot voll und nach kurzer Fahrzeit ist man ein paar hundert Meter versetzt am anderen Ufer angekommen.
Dort braucht man nur eine Straße zu überqueren und befindet sich in einem weiteren Souk, dem Spice Souk, wo man sich auf Gewürze spezialisiert hat.
Neben den mehr oder weniger bekannten Gewürzen sieht man so allerlei Unbekanntes und Fremdes. Man schnuppert, schaut und staunt.
Auf Nachfrage unterrichtete man uns sehr freundlich, dass zum Beispiel die seltsamen gelblichen Stangen aus Schwefel bestehen. Damit kann man sich einreiben, um so Hautallergien zu bekämpfen. Oder dass es sich bei den seltsamen tischtennisballgroßen blauen kugeligen Gebilden um Indigo handelt, womit man bei Waschen die Farbe von Jeans auffrischen kann.
Wir kauften 10 Muskatnüsse, noch in der Schale (so bleiben sie länger frisch) und ein Tütchen mit Ingwerpulver. Die Preisverhandlungen erfolgten in einer ruhigen, freundlichen und friedlichen Atmosphäre.
Im Viertel rund um den Spice Souk waren die Geschäfte geschlossen. Mehr zufällig stolperten wir über den Gold Souk. Hier waren nur etwa ein Viertel der Schmuckläden geöffnet. Das waren, bezogen auf unser Kaufinteresse eigentlich immer noch zu viele, aber der Gesamteindruck, wenn alle Geschäfte offen und alle Rollläden vor den Schaufenstern hochgezogen wären, wäre sicherlich um etliches prunkvoller gewesen.
Aber trotz der Schilder, die versicherten, dass es heute bis zu 70% Rabatt gäbe, lockte man uns in keines der Geschäfte, sondern wir begnügten uns mit dem Betrachten der Auslagen im Schaufenster und waren mit dem Gold Souk relativ rasch durch.
Mit dem Fährbötchen wechselten wir wieder zum gegenüberliegenden Ufer, wo wir ein Restaurant fanden, dessen hölzerne Terrasse direkt am Ufer lag und sogar noch ein Stück in den Fluss ragte. Hier bekamen wir einen Logenplatz direkt an der Brüstung, tranken einen Limetten-Pfefferminzsaft und genossen lange das geschäftige Treiben auf dem Fluss. Die Fährboote fuhren, wie aufgereiht an einer Perlenschnur hin und her, ab und zu passierte eine Dhau die Szenerie.
Für den Rückweg ein Taxi zu entdecken und herbeizuwinken war auch kein Problem.
So kamen wir wohlbehalten und sehr zufrieden wieder auf unserer Artania an.
Gestern wurden 70 Tonnen Lebensmittel geladen. Hurra, alkoholfreies Weizenbier war auch dabei, und befundet sich seit heute wieder im Ausschank befand. Wir erfuhren von diesem glücklichen Umstand, weil uns der Barmanager 2 Flaschen davon auf Kosten des Hauses auf unsere Kabine geschickt hatte.
Um 21.15 Uhr mussten wir wieder (zum 7. Mal) an der obligatorischen Rettungsübung teilnehmen und um 23.00 Uhr legten wir ab.
123. Reisetag - Samstag, 22.04.2017 Abu Dhabi/Vereinigte Arabische Emirate
Um 7.30 Uhr machten wir nach nur 90 Seemeilen(166 Km) in Abu Dhabi fest. Abu Dhabi ist die Hauptstadt des gleichnamigen Emirats, hat 650.00 Einwohner, also nur ein Viertel der Einwohner von Dubai. Trotzdem steht es in Bezug auf Prunk, Hochhäuser und gezeigtem Reichtum gegenüber dem Nachbaremirat in nichts nach.
Da wir gestern so problemlos Taxi gefahren sind, wollten wir diese Art der Erkundung eines Reiseziels wiederholen.
Gegen 9:45 Uhr verlassen wir über die Gangway die Artania, begeben uns ins Passagierterminal, lassen unsere Rucksäcke durchleuchten, ignorieren die Tourenanbieter und gelangen durch den Ausgang zu den regulären Taxen.
Wir wollen erst einmal zum Emirates Palace, ein luxuriöses Hotel, das man gesehen haben muss, sagt zumindest der Reiseführer und die emiraterfahrenen Mitreisenden. Danach? Schau’n wir mal!
Bei den Taxen fängt uns sofort ein sogenannter „Dispatcher“ ab. Das ist einer, der die Fahrgäste den einzelnen Fahrzeugen zuordnet.
Leider wollte besagter Dispatcher uns nicht die gewünschte Fahrt zum Emirates Palace Hotel vermitteln, sondern eine mehrstündige Tour verkaufen. Eine einfache Fahrt von A nach B war angeblich nicht möglich.
Also lassen wir die Nervensäge links liegen und gehen selbst zu einem Taxi. Aber auch hier lehnt man unser Ansinnen kategorisch ab, mit der Begründung, man stehe seit 6.00 Uhr hier und da lohnt sich so eine kleine Fahrt nicht. Das ist durchaus verständlich, aber bei allem Verständnis wollen wir doch selbstbestimmt unseren Tagesablauf planen und durchführen.
Deshalb fahren wir erstmal mit dem kostenlosen Shuttlebus bis zum ca. 2 Kilometer entfernten Hafenausgang und fischen dort ein Taxi aus dem laufenden Verkehr. An der Einfahrt zum Hotelgelände werden wir von einem Sicherheitsmann in Augenschein genommen, für gut befunden und durch gewunken und fahren noch gut 200 bis 300 Meter, bis wir vor dem Hoteleingang stehen.
Wir zahlen den Preis laut Taxameter (ca. 7 $).
Ein livrierter Bediensteter des Hotels öffnet die Fahrzeugtüre und wir schreiten unbehelligt ins Foyer.
Hier wurde nicht gekleckert, sondern geklotzt. Weit ausladende Hallen und Gänge und überall Marmor deuten an, dass hier die Übernachtung mehr als 60€ kostet.
Der gemeine Tourist darf natürlich nicht überall hin. Die meisten Teile des riesigen Komplexes, wie zum Beispiel auch der Garten- und Strandbereich, sind den Hotelgästen vorbehalten und darauf wird durch höfliche, gut gekleidete
Sicherheitsleute geachtet.

An der Hotelbar nahm jeder noch einen ganz gewöhnlichen Drink, Limonensaft bzw. Cola. Wir hätten uns auch einen Cappuccino bestellen können, der wird hier noch zusätzlich mit Blattgold bestreut. Ganz so versnobt waren wir dann aber doch nicht.
Wir lustwandeln noch eine Zeitlang durch das edle Gemäuer, benutzen die äußerst noblen „Restrooms“ (Toiletten) ...
... und surften in einer Sitzecke ein wenig im kostenlosen WLAN.
Und siehe da, durch Zufall bemerke ich die unangenehmen Seiten der Emirate, die uns ja mit dem ganzen Prunk und Protz ein modernes Märchen von Tausendundeiner Nacht vorgaukeln wollen. Als ich nämlich aus der Übersicht von „Google News“ eine Fußballmeldung anklicke, wird mir der Zugang zur angewählten Seite verweigert. Jetzt erst bemerke ich, dass die Meldung auf der Homepage von www.bild.de stand. Um der Sache auf den Grund zu gehen, rufe ich die Homepage der Bildzeitung auf und wieder wird der Zugang blockiert.
Ich glaube, das nennt man schlicht und ergreifend Zensur, in meinen Augen eine ganz üble Sache. Wo es keine Pressefreiheit gibt, ist Willkür und Unrecht nicht weit, da nutzen auch keine goldenen Wasserhähne auf dem Klo.
Wir liefen durch den großzügig angelegten Vorplatz (Wasserspiele, Marmor) des Hotels bis zur Einfahrt und nehmen eines der Taxen, die mittlerweile scheinbar im Sekundentakt Hotelgäste und schaulustige Touristen wie uns vor den Hoteleingang gekarrt haben und nun leer irgendwohin zurückfahren wollen.
Als wir heute früh angekommen waren, waren nur ganz wenige Leute auf Besichtigungstour im Emirates Palace. Jetzt zur Mittagszeit, strömten die Massen.
Wir wollten nun zur „Großen Moschee“, genauer der Sheikh Zayed Mosque, die sich laut Stadtplan gar nicht so weit vom Emirates Palace befindet und uns als absolut sehenswert empfohlen wurde.
Der Taxifahrer war sehr nett und erklärte uns während der Fahrt, was wir gerade sehen bzw. wo wir gerade vorbeifahren. So erklärte er, dass das Grundstück, an dem wir gerade vorbeifuhren mit den Wohnhäusern bzw. Wohnpalästen der herrschenden Familie (Sultans oder Emirs oder was auch immer) gehöre. Dieses Anwesen zog sich über ein bis zwei Kilometer hin. Unser Fahrer erklärte Stolz, dass der herrschende Sultan noch 18 Brüder hätte. Auf Doris‘ Frage, wieviel Schwestern es gäbe und mit wie vielen Frauen Papa Sultan denn diese ganze Mischpoke gezeugt hätte, konnte er nur mit geschätzten Zahlen rüberkommen. Frauen sind halt eher bedeutungslos.
Mit der Zeit wurden wir jetzt langsam unruhig, denn er fuhr und fuhr und fuhr und zwar ganz anders, als wir zumindest ganz grob nach dem Stadtplan hätten fahren müssen.
Und da unser Vertrauen in die Taxi-Innung schon einige Risse bekommen hatte, unterstellten wir dem Fahrer böse Absichten. Die Konstellation Große Moschee und Taxi ging ja schon in Dubai nicht gut. Doris zeigte ihm auf der Karte die Moschee, wo wir hin wollten. Der Fahrer aber meinte, das sei nicht die „Große Moschee“, denn die liege ca. 20 Kilometer im Westen der Stadt.
Die Diskrepanz zwischen unserer Ortskenntnis und der des Fahrers klärte sich nach geraumer Zeit wie folgt:
Die Moschee, die auf Stadtplan als Piktogramm eingezeichnet war, war gar keine Moschee, sondern ein Basar, der sich „Grand Store“ nennt. Genau unterhalb dieses Piktogramm ist eine Straße eingezeichnet, die sich „Zayed The First St.“ nennt. Wir hatten also die Worte „Grand“ (engl.: groß) und „Zayed The First“ gesehen und daraus „Sheikk Zayed Mosque“ geformt.
Also: Guter Taxifahrer, aber doofer Tourist!
Die lange Fahrt war zwar nicht sonderlich teuer (45 AED = 12 $), ließ aber unseren kleinen Vorrat an Emiraten-Talern arg schmelzen.
Donnerwetter, die Moschee war tatsächlich „grand“.
Da wir jetzt schon mal da waren, wollte ich auch zumindest auch die Plätze und Säulengänge besichtigen. Dazu musste man aber zunächst durch eine Sicherheitskontrolle - Männer und Frauen getrennt, das war nicht weiter schlimm.
Jetzt musste sich Doris allerdings in ein für sie viel zu großes wallendes Gewand mit Kapuze hüllen, was sie nur mit großem Missbehagen über sich ergehen ließ. Nicht unbedingt das Gewand an sich, sondern die Tatsache, dass nur Frauen diesen Mummenschanz vollführen müssen, diese Willkür des männlichen Diktats, erregte ihren Unmut. Und nur mir zuliebe und unter Protest stimmte sie der Verkleidung zu. Ich selbst durfte mich so wie ich war, mit meinem touristischen Outfit auf das Moscheegelände begeben.
Nach der Besichtigung bestiegen wir ein Taxi, die hier reichlich und ohne Dispatcher auf Kundschaft warteten.
Wir kamen mit dem Fahrer, ein Albaner, ins Gespräch. Er zeigte sich empört über die Taxifahrer am Hafen, die uns nicht fahren wollte, Er selbst hätte dort auch 3 Stunden erfolglos gestanden und hätte dann aufgegeben. „So sei das in dem Geschäft eben“ meinte er.
Er fuhr uns direkt bis vor das Hafenterminal. Als es ans Zahlen ging, reichten unsere arabischen Taler nicht mehr ganz, es fehlte genau ein Dirham (ca. 0,20 €). Aber der gute Mann meinte, das wäre auch so in Ordnung. Klar, dass er ein Trinkgeld bekommen hat und zwar in US-Dollars.
Um 18.00 Uhr hieß es „Adios Vereinigte Arabische Emirate“ mit dem neuen Ziel Oman.
124. Reisetag - Sonntag, 23.04.2017 Khasab/Oman
Bis 1970 war das Sultanat Oman ein unterentwickeltes, rückwärtsgewandtes Land, weil der Sultan ein erzkonservativer Mann war. Der Sohn dieses Sultans hat es irgendwie geschafft, den Alten nach England abzuschieben und hat sich selbst auf den Thron gesetzt. Er schaffte in den letzten 4 Jahrzehnten ein modernes Oman, in dem er Schulen, Krankenhäuser bauen ließ und eine moderne Verwaltung installierte. Fehlendes Know How beschaffte er, in dem er hochqualifizierte ausländische Fachkräfte ins Land holte und diese nach und nach durch inzwischen gut ausgebildete Omanis ersetzen lies. Er installierte ein Sozialsystem, wie Rente, Arbeitslosengeld etc. Es gibt auch ein Parlament, das aber nur beratende Funktion hat, entscheiden tut der Sultan. Wohl und Wehe des Landes hängen also ausschließlich von den Dekreten des Sultans ab. Bis jetzt ist das einigermaßen gut gelaufen, aber wehe der Sultan wird irre oder bösartig oder geistesgestört. Was der Sultan, der kinderlos ist, allerdings bisher vergessen hat, ist eine Nachfolgeregelung zu schaffen. Er ist jetzt 74 und so viel mir bekannt ist, leben auch Sultane nicht ewig. Oman sollte also schleunigst den Wechsel von der absoluten Monarchie zur konstitutionellen Monarchie vollziehen.
Quelle: Reiseblog 2013 von Peter Hölzer
(https://hoe2013a.wordpress.com/2013/05/08/oman-2/)
Früh morgens um 7.00 Uhr hatten wir in unserem ersten Hafen im Oman festgemacht. Der 18.000 Einwohner zählende Ort Khasab selbst ist einige Kilometer entfernt. In der Landgangsbeschreibung von Phoenix war nicht viel herauszulesen, was uns dort eigentlich erwartet.
Es stand ein kostenloser Shuttlebusbus, den wir auch nutzen wollten. Wir saßen schon im Bus und warteten auf die Abfahrt, als ein Omani einstieg und für eine Fahrt mit einer Dhau warb. Reflexartig lehnte ich erst einmal ab, aber er hielt uns, ohne die anderen Fahrgäste weiter zu beachten, die auch abgelehnt hatten, eine Karte mit der Fahrtroute unter die Nase, erzählte etwas von Kaffee, Tee und Delfinbeobachtung und weckte tatsächlich unser Interesse. Warum eigentlich nicht? Spontan entschieden wir uns, die Dhaufahrt mitzumachen. Aber warum hatte der „Vertriebsbeauftragte“ genau uns im Visier? Hatten wir schon gleich von Beginn an ein Flackern in den Augen, von dem wir selbst noch nichts wussten und er hat es erkannt? Wie dem auch sei, wir stiegen aus dem Bus wieder aus und gingen zu einem nahgelegen Anleger. Man hatte uns einen Zettel mitgegeben auf dem Stand handschriftlich 50€, der Preis für uns beide zusammen und der Name des „Vertriebsmannes“.
Vor dem Einstieg saß an einem Tisch der Kassierer. Erst jetzt kam uns in den Sinn, dass wir gar keine Euros einstecken hatten, sondern nur Dollars. Wir zeigten ihm kurz den Zettel und legten 50$ auf den Tisch und das wurde ohne Murren akzeptiert und erhielten sogar eine Quittung.
Wir schon öfter erlebt, dass zwischen Dollar und Euro kein Unterschied gemacht wird, also der Wechselkurs mit 1:1 angenommen wird, obwohl der Dollar tatsächlich nur 90 Euro-Cent wert ist. Das lässt sich so halt leichter rechnen und wer mit Euro bezahlt, bezahlt eben 10% mehr, was bei Bagatellkäufen, wie z.B. Kühlschrankmagneten, auch unerheblich ist.
Eine Dhau ist eigentlich ein spezieller hölzerner Segelschifftyp, aber die modernen Dhaus haben aussch ließlich einen Motor und keine Segel mehr.
Die Aufbauten unserer Dhau waren sehr einfach, aber urig gemütlich. Man saß auf dem Boden auf Teppichen und Polstern. Ein Sonnendach aus Segeltuch spendete ausreichend Schatten. Das Publikum war international, knapp 20 Leute und nur 2 weitere Phoenix-Leute waren an Bord. Und wer war das wohl von den Phoenix-Mitreisenden? Anne und Wolfgang, die waren nach einem Kurzaufenthalt aus Khasab mit dem Shuttle zurückgekehrt und wurden ebenfalls erfolgreich geworben, ebenfalls für 50$. Handeln sei zwecklos gewesen, wie sie uns erzählten.
Die Fahrt führte an schroffen Felslandschaften vorbei in diverse Buchten.
Es wurde Obst, Kaffee, Tee, kandierte Datteln und Kaltgetränke gereicht.
Der Aussagen unseres Werbers „playing with dolphines“ (Spielen mit Delphinen) hatte ich keinen großen Glauben geschenkt. Wir hatten in der Vergangenheit auf anderen Reisen schon etliche Bootsfahrten gemacht, wo man uns Walbeobachtungen versprochen hatte und wir außer ein paar Wasservögeln nichts weiter zu sehen bekamen. Es ist ja allgemein bekannt, dass Walversprechungen in der Regel nicht eingehalten werden. Und wieso sollte es bei Delfinen anders sein?
Aber diesmal hatten wir Glück. Eine Gruppe Delfine schwamm und sprang neben dem Boot her, ein tolles Erlebnis. Zwar spielten nicht wir mit den Delfinen, sondern sie mit unserer Bugwelle, aber wir waren mehr als zufrieden.
In einer weiteren Bucht ankerten wir und es gab die Gelegenheit zum Schwimmen und Schnorcheln. Aber da wir wegen unserer Spontanbuchung keine Badesachen dabei hatten, blieben wir an Bord.
Auf der Rückfahrt kamen wir ins Gespräch mit einer jungen Frau, die, wie sich herausstellte aus Wien stammt und in Dubai arbeitet. Sie konnte uns viel über ihre Arbeit, das Leben, den Alltag und die Besonderheiten in diesem exotischen Land berichten. Das war mit Sicherheit Interessanter und Unterhaltsamer als das, was man von Reiseführer bei Ausflugsfahrten erzählt bekommt.
Die vier Stunden auf der Dhau sind wie im Flug vergangen.
Vor der Abfahrt der Artania um 15.00 Uhr konnten wir noch von der Reling aus dem Treiben der iranischen Schmuggler im Hafen zuschauen. Diese kommen mit kleinen Booten beladen mit Schafen und Ziegen nach einer eineinhalbstündiger Überfahrt aus dem nahegelegen Iran und tauschen die Tiere gegen Elektronik und Zigaretten. Das Ganze wird unter den Augen der omanischen Polizei geduldet, praktisch ein kleiner Grenzverkehr ohne gesetzliche Grundlage.
125. Reisetag - Montag, 24.04.2017 Muscat/Oman
Muscat (andere Schreibweise: Maskat) ist die 30.000 Einwohner zählende Hauptstadt des Omans.
Für heute hatten wir bereits vor Tagen bei Phoenix einen Ausflug gebucht. Man glaubt es kaum - eine Fahrt mit einer Dhau.
Zwar ist unsere letzte Dhaufahrt noch nicht allzu lange her, aber wir wollten die heutige Fahrt trotzdem nicht stornieren, obwohl, wie wir seit meiner damaligen Stornierung für Kuala Lumpur wissen, dass die Stornogebühren in der Regel nicht sehr hoch sind.
So traten wir also um 9.00 Uhr unseren Ausflug an. Ich kann ja das Ganze unter dem Motto verarbeiten:
„Dhaufahrt gestern und heute - eine vergleichende Analyse“ :-)
Mit einem kurzen Bustransfer von 15 Minuten erreichten wir den Anleger und bestiegen mit gut 30 Leuten das Schiff.
Es gab im Gegensatz zu gestern ein zusätzliches Oberdeck, einen klimatisierten Raum mit Bänken und Tischen und Einrichtungen für ein Catering. Im Außenbereich saß man nicht auf Polstern, sondern auf richtigen Bänken. Alles war ein wenig gediegener und komfortabler, dafür etwas weniger urig.
Während der Fahrt wurden wir mit Tee, Kaffee, Kaltgetränken, sowie kandierten Datteln versorgt, also ähnlicher Service wie gestern.
Baden und Delfine waren nicht vorgesehen, folglich wurde auch nicht gebadet und Delfine kamen deshalb auch keine vorbei.
Zu sehen gab es diesmal nicht nur Landschaft, sondern am Ufer sah man auch den Sultanspalast, Hotels und Ortschaften und nicht zuletzt den Hafen, wo unsere Artania lag.
Alles in allem war auch diese Fahrt sehr schön, aber die gestrige war noch etwas schöner.
Negativ anzumerken ist leider die Lustlosigkeit der Phoenix-Ausflugsbegleitung. Deren Aufgabe war es unter anderem gewesen, die englischen Ausführungen des örtlichen Reiseleiters zu übersetzen.
Wir haben z.B. mitbekommen, dass dieser ihr die Sicherheitsvorrichtungen des Schiffs (z.B. wo sind die Schwimmwesten) erklärte, informierte wo die Toiletten versteckt waren, wo man sich auf dem Schiff bewegen darf und wo nicht und noch so einiges mehr. Er sprach zu ihr mehrere Minuten. Im letzten Satz erwähnte er, dass man linker Hand einen weiteren Palast des Sultans sehen würde.
Und genau diesen letzten Satz hat sie uns in Deutsch verkündet und hat alles andere komplett unter den Tisch fallen lassen.
Nach der Fahrt mit der Dhau brachte uns unser Bus noch zum nahe beim Hafen gelegenen Souk, wo wir eine Stunde frei rumlaufen durften, bis wir dann vom Bus zum Hafen zurückgebracht wurden.
Da es wieder mal sehr heiß war, verbrachten wir den Nachmittag mit Faulenzen und sahen von weiteren Erkundungen in Muscat ab.
Um 18.00 Uhr legte die Artania ab.
126. Reisetag - Dienstag, 25.04.2017 Seetag
Ich arbeite fleißig weiter am Blog. Sonst keine besonderen Vorkommnisse!
Das gibt mir die Gelegenheit, über eine kuriose Sitte beim Frühstück zu berichten.
Dabei gelingt es uns nämlich fast nie, unseren Teller vom Buffet zu unserem Tisch zu tragen. Irgendwo lauert uns immer ein Kellner auf, reißt uns den Teller aus der Hand und trägt ihn zu unserem Tisch und man selbst trabt hinterher.
Wenn man meint, man hätte es doch einmal geschafft, alleine den Teller zu transportieren, weil es bis zum Tisch nur noch ein knapper Meter ist, hat man sich schwer getäuscht. Schwupp ist man seinen Teller wieder los. Nur trabt man diesmal nicht hinter dem Kellner her, denn zwischen Stuhl und Gast gar kein Platz mehr für den eifrigen Dienstleister.
Es gibt zwei Möglichkeiten, die Kellner auszutricksen.
1. Man geht direkt auf den Kellner zu, täuscht links an und geht rechts vorbei.
2. Ich verabrede mit Doris, dass wir an verschiedenen Buffetabschnitten etwas holen und dann gleichzeitig auf unseren Tisch zusteuern. Mit etwas Glück schafft es dann einer von uns beiden.
127. Reisetag - Dienstag, 26.04.2017 Salalah/Oman
Das Sultanat Oman ist dafür bekannt, dass hier aus Baumharzen Weihrauch hergestellt wird und Salalah gilt als Hochburg des Weihrauchs.
Allerdings werden wir keines dieser Räucherharze erwerben, weil wir damit zu Hause schon vor einigen Jahren einmal erfolgreich unsere Wohnzimmerdecke geschwärzt hatten.
Um 11.30 Uhr haben wir im Containerhafen festgemacht. Bis Salalah sind es 22 Kilometer. Da zwischen 13.00 und 16.00 Uhr die meisten Geschäfte geschlossen sind und überhaupt in dieser Zeit wegen der Hitze das Leben fast zum Erliegen kommt, sahen wir von einer Fahrt dorthin ab, zumal wir um 18.00 Uhr schon wieder ablegen sollten.
DEn Transfer zum nahegelegen Hilton Ressort für 45€ pro Person (einschl. „Eintritt“ ins Ressort plus Willkommensdrink), der von Phoenix angeboten wurde, nahmen wir ebenfalls nicht wahr. Vor vier Jahren waren wir mit der MS AMADEA schon einmal hier und nutzen das Transferangebot. Das Ressort war ganz OK, aber der Strand inakzeptabel (siehe auch: Reiseblog 2013 - Oman).
In der Nähe des Hafenausgang (10 Minuten Fußweg) sollte es einen Strand geben. Allerdings wurden gab Reiseleitung dringende Warnhinweise, wegen starker Unterströmungen dort nicht zu schwimmen.
Zum Hafenausgang fuhr und ein kleiner Shuttlebus. Die am Ausgang wartenden Taxifahrer waren nicht aufdringlich. Im Gegenteil, sie zeigten uns die Richtung zu besagtem Strand, meinten jedoch, es sei besser mit Ihnen nach Salalah zu fahren, da der Strand nur winzig sei.
Und so war es auch.
Nach einem Spaziergang bei brütender Hitze durch eine trostlose Gegend kamen wir an eine hübsche Bucht, die wirklich sehr übersichtlich war. Zumindest konnte man ein wenig durch das klare Wasser waten.
Am Strand stand ein verwaister Geländewagen, der sich im Sand festgefahren hatte. Aber nach einiger Zeit kam der Besitzer mit zwei Helfern, um zu versuchen, den Wagen wieder flott zu bekommen. Aber ohne Schaufeln, nur mit den Händen ein wenig grabend, war das Projekt zum Scheitern verurteilt. Mit jedem Versuch frei zu kommen, grub sich der Wagen tiefer in den Sand ein. Man kam schließlich zu der Erkenntnis, dass man das Fahrzeug irgendwie herausziehen müsste. Wie das Unternehmen schließlich ausgegangen ist, kann ich leider nicht berichten, denn wir begaben uns wieder Richtung Hafenaus- bzw. Eingang.
Unterwegs mussten wir noch ein Foto mit einem uns begegnenden Omani machen und damit war unser Landgang auch schon zu Ende.
Der Versuch, uns am Pool der Artania ein wenig zu erfrischen, war bei knapp 30 Grad Wassertemperatur nur mäßig erfolgreich.
Pünktlich um 18.00 Uhr verließen wir unseren letzten Hafen im Oman und nahmen Kurs auf unser nächstes Ziel, Hurghada in Ägypten. Vor uns lagen 4 volle Seetage.
128. Reisetag - Donnerstag, 27.04.2017 Seetag
Wir befanden uns in einer „High Risk Area“, ein Fahrgebiet, in dem es in der Vergangenheit etliche Angriffe und Schiffsentführungen durch somalische Piraten vom Horn von Afrika gegeben hat.
Wir befuhren einen besonders durch Marine besonders gesicherten Korridor im Konvoi mit einigen anderen Schiffen. Kriegsschiffe bekamen wir keine zu Gesicht und auch vom den anderen Schiffen des Konvois sahen wir lediglich von einigen nur nachts die Lichter. Die Abstände waren demnach doch beträchtlich.
Zusätzlich wurde back- und steuerbord an der Reling je eine Wache aufgestellt. Außerdem wurden wir angewiesen, im Falle eines Piratenalarms mit der Schwimmweste die Kabine zu verlassen und sich auf dem Gang davor einzufinden.
Um die Spannung vorwegzunehmen, es ist nichts passiert. Es fanden in den letzten Monaten keine Übergriffe mehr statt. Das Geschäft ist mittlerweile zu riskant geworden.
129. Reisetag - Freitag, 28.04.2017 Seetag
Auch an diesem Seetag bot das Tagesprogramm allerlei Kurzweil. Um 11.15 Uhr fiel wieder mal der Startschuss für die Bordolympiade. Vier Mannschaften (Crew-Team, Phoenix-Team, Offizier-Team, Passagier-Team) kämpften um Punkte.
Man kann sich diesen Wettbewerb aus einem Zwischending von „Spiel ohne Grenzen“ (falls sich noch jemand an diese Sendung erinnert) und einem Kindergeburtstag (Sackhüpfen, Eierlaufen,..) vorstellen.
Wer gewonnen hat, kann ich leider nicht sagen, denn ich musste wieder mal wegen Rückstand bei der Blogarbeit nachsitzen.
Vor dem Mittagessen schwammen wir noch ein halbes Stündchen im Artania Pool.
Der Kaffeestunde, die heute unter dem Motto „Alles Schokolade“ stand, blieb ich lieber fern, sonst hätte ich heute nach dem Abendessen kein Eis mehr essen dürfen - Doris und ich passen ein wenig aufeinander auf.
130. Reisetag - Samstag, 29.04.2017 Seetag
Heute ist wieder mal ein Galaabend - die Mittelgala dieses Reiseabschnitts.
Da ich mich ja bereits genügend über Galaabende im Allgemeinen und Besonderen ausgelassen habe, erzähle ich jetzt lieber von einer netten Unsinnigkeit im Lido-Restaurant
Hier bekommt nicht jeder wie im Artania-restaurant beim Frühstück seinen Teller zum Tisch getragen, den zur Mittags- und Abendzeit sind die Kellner doch sehr gut mit Abräumen, Getränke Nachschenken etc. ausgelastet, während sich im Artania-Restaurant die Kellner beim Frühstück eher langweilen, weil der Großteil der Passagiere im Lido weilt.
Wenn man Platz nun im Lido zum Mittag- oder Abendessen einen Platz gefunden und sich gesetzt hat, wartet man, dass man die Getränkebestellung aufgegeben hat und der Kellner den einfachen Rot- oder Weißwein, einen Apfelsaft oder das Wasser (still) gebracht hat. Andere Getränke werden eher wenig getrunken, denn die muss man extra bezahlen. Die Getränkelieferung wartet man am besten erst ab, denn damit ist signalisiert: „Der Platz ist nun belegt.“. Jetzt könnte man eigentlich zum Buffet schreiten, aber zunächst muss man seine riesengroße Serviette wieder vom Schoß nehmen und etwas platzsparender wieder zusammenlegen und auf den Tisch zurücklegen. Denn mit der Getränkelieferung legt einem der Kellner die Serviette liebevoll auf den Schoß.
Eine Geste, die in den anderen beide Restaurants im Schiff, wo man seine Speisen serviert bekommt, durchaus seine Berechtigung hat.
Die meist philippinischen Kellner machen das, weil man sie so angewiesen hat, aber von der oberen Heeresleitung hat anscheinend noch niemand bemerkt, dass dieser Service im Lido eher sinnentleert ist.
Aber andererseits haben wir jedes Mal Spaß an dieser Zeremonie.
131. Reisetag - Sonntag, 30.04.2017 Seetag
An Seetage findet immer nachmittags um 14.00 in meinem „Büro“ ein Skatturnier statt und zwar seit Anbeginn der Weltreise. Für die drei Erstplatzierten gibt es eine Medaille und eine Urkunden für die 3 Bestplatzierten und zusätzliche eine Flasche Sekt für den Sieger.
Gestern ging ein dreitägiges Turnier zu Ende, heute startete ein Neues.
Der 3. Mai ist ebenfalls als Turniertag vorgesehen ist, obwohl das gar kein richtiger Seetag ist, denn dann findet die Passage durch den Sueskanal statt.
Vorsichtshalber fragte Moritz von der Phoenix Reiseleitung, der die Turniere organisiert und auch die anschließenden Siegerehrungen vornimmt, die Spieler, ob jemand wegen der Suez-Passage an diesem Spieltag nicht teilnehmen möchte. Es meldete sich niemand ab, vielmehr erläuterte ein Skatbruder die Situation wie folgt:“ Was gibt es da zu sehen? Rechts Sand, links Sand und ab und zu mal eine Palme. Uninteressant!“
Einem Ehepaar, das an einem benachbarten Tisch Rummikup spielte, entgleisten ob dieser Aussage fast sämtliche Gesichtszüge und sie flüsterten mir zu: “Weges des Suezkanals haben wir doch diese Reise von Dubai nach Venedig überhaupt gebucht.“
Ja, so sind die Wahrnehmungen und Interessen der Menschen doch arg verschieden.
Aber ich schließe mich gerne der Auffassung des Skatbruders an, denn dann brauche ich über diesen Tag gar keinen oder nur einen ganz kurzen Bericht anfertigen. ☺
Um 16.00 Uhr fand wieder einmal der
MS Artania „FernSEEgarten“
statt.
Selbstredend konnten die Skatspieler, die mit der Tagesdosis an Spielen noch nicht fertig waren, zu dieser Veranstaltung nicht pünktlich erscheinen.
Geboten wurde unter anderem ein Eisschnitzer, der innerhalb weniger Minuten aus einem Eisblock eine Skulptur herausarbeitete. Die Zuschauer sollten im Anfangsstadium dieser Arbeit raten, was es denn werde.
Die Antwort ist sehr einfach - es wird ein Indianer. Natürlich kann man das erst ganz zum Schluss erkennen, aber ich habe von äußerst geübten Kreuzfahrern erfahren, dass er seit Jahren beim „Schauschnitzen“ immer einen Indianer herstellt.
Er kann natürlich noch andere Motive „schnitzen“, wirklich sehr kunstvolle und schöne, das haben wir schon öfter auf dieser Reise bestaunen dürfen. Wenn es aber schnell gehen muss, scheint der Indianer für ihn die beste Wahl zu sein.

Jiri Erlebach ist seines Zeichens eigentlich ein auf Kreuzfahrtschiffen populärer (Teufels-) Geiger, aber heute brillierte er als Sänger mit Liedern von Elvis Presley.
Seinen Pferdeschwanz band er einfach nach vorne - fertig war die Elvis-Tolle. Und die Kotletten waren Bestandteil der Sonnenbrille, was mich am meisten beeindruckt hat. ☺
Mit diversen Gesangsdarbietung unter anderem von „Elvis“, Seemannslieder von dem aus Passagieren bestehenden Artania Chor und weiter mit einer kleine Kochshow, eine Modeschau mit Klamotten aus der Schiffsboutique und Ähnlichem, wurde versucht, einer beim Gast eventuell aufkommende Langeweile entgegenzuarbeiten. Zwar hatte ich keine Langeweile, aber um meiner Informationspflicht als Reiseberichterstatter nachzukommen, war ich bei diesem Event anwesend.
132. Reisetag - Montag, 01.05.2017 Hurghada/Ägypten
Hurghada ist das größte ägyptische Tourismuszentrum, liegt an der Westküste am Roten Meer und hat 160.000 Einwohner.
Der für heute gebuchte vierstündige Badeausflug ging um 8.40 Uhr los, was bedeutete, eine halbe Stunde früher aufzustehen. Der Bus fuhr brauchte etwa 10 Minuten, um uns vom Hafen in das Ressort „Juwels Sahara“ zu fahren. Diese kurze Fahrt war recht aufschlussreich, wie es um die Tourismusbranche in Ägypten steht, nämlich sehr schlecht. Man sah jede etliche Bauruinen oder ehemalige Hotels, die geschlossen und dem verfall preisgegeben sind. Etwas abgenutzt
Das Ressort, wo wir mit zwei Bussen hingebracht wurden, war recht nett, aber teilweise etwas abgenutzt. Bei den Holzliegen blätterte der lack ab, die Auflagen waren fleckig und der ein oder andere Sonnenschutz aus Stroh war recht löchrig.
Es gab nur wenige Hausgäste, meist russischer Nationalität, sodass Phoenix über den kleinen Strandabschnitt die Oberhoheit gewann.
Es herrschte Clubatmosphäre mit Musik und Animationsprogramm und erinnerte mich an meinen ersten Pauschalurlaub vor langer langer Zeit.
Bei den bisherigen Badeaufenthalte auf dieser Reise war das Wasser immer sehr angenehm bis badewannenwarm, doch hier herrschte ein erheblicher Abkühlungseffekt, zwar nicht so ganz so heftig wie an der Ost- oder Nordsee, aber doch so, dass man beim hineinwaten ins Wasser zunächst einmal immer größer wurde, um das kühle Nass möglichst lange vom Bauchnabel fern zu halten. Aber dann galt die alte Badeweisheit:“ Wenn man erst mal drin ist, geht’s.“
Wie bei Halbtagesausflügen üblich, kamen wir so zum Schiff zurück, dass man noch schnell Mittagessen konnte, ehe die Restaurants wieder schlossen.
Da die Speisekarte uns heute nicht besonders gefiel, wollten wir mal wieder den Kabinenservice nutzen und bestellten wir uns an der Rezeption ein Schnitzel und einen Cheeseburger mit der Bitte, die Sachen nicht in die Kabine sondern in die Kopernikusbar schicken zu lassen, weil wir dort auch noch ein Weizenbier (non-alcoholic) trinken wollten.. Das hatte bisher immer gut geklappt. Nur heute dauerte es geschlagenen eineinhalb Stunden, bis wir den ersten Bissen zu uns nehmen konnten. Erst hat der Rezeptionist vergessen, die Bestellung an die Küche weiterzugeben (kann in der Hektik schon mal passieren) aber dann musste der Koch wohl erst in die Stadt zum Metzger, um einzukaufen. Zwischenzeitlich wurden wir ´mit Fehlinformationen versorgt. Zunächst wurde versichert, dass die Zubereitung 10 Minuten dauere, und nach einer weiteren halben Stunde wurde die Parole ausgegeben, dass der Steward bereits mit Schnitzel und Burger zu uns unterwegs sei. Nach einer weiteren Viertelstunde war unser Essen plötzlich immer noch nicht da.
Dass einem da die Hutschnur platzt und wir uns beim sogenannten Hoteldirektor, der unter anderem Chef von Küche und Service (Stewards) ist, beschwerten ist doch verständlich - oder?
Dass wir dann doch noch etwas zu Essen bekamen hat uns sehr gewundert, aber auch mit großer Freude und Dankbarkeit erfüllt. Wo es letztlich geklemmt hat, konnte oder wollte man uns nicht sagen.
Nachdem sich unser Ärger gelegt hatte, ging es in die Stadt auf Erkundungsgang. Zwar hatten wir keinen Stadtplan und auch keine Vorstellung, was und erwartet, aber man konnte vom Hafenausgang aus eine große Moschee sehen, die man leicht zu Fuß erreichen konnte.
Von dort aus ließen wir uns durch die Straßen treiben. Da man von fast überall die Minarette der Moschee sehen konnte, konnten wir uns auch nicht verlaufen.
Die Geschäfte und Läden waren wirklich sehr „landestypisch“, was mich aber nicht abhalten sollte, einen Friseur aufzusuchen, denn mein Haupthaar hatte es wieder einmal nötig.
Interessant war ein uns bisher völlig unbekannte Methode, Gesichtshaare (Flaumhärchen, nicht Barthaare) mit Hilfe eines Fadens zu entfernen. Dazu wurde man erst mit einem weißen Pulver bestäubt und dann legte er los. Das zwirbelte recht ordentlich, Genuss geht anders.
Diese Prozedur war aber im Preis von 5 US-Dollar für den Haarschnitt enthalten.
Auch Doris ließ sich zu einer Behandlung überreden. Ihre Behandlung war allerdings nicht in meinem 5$-Haarschnitt mit inbegriffen (wie hinterher bemerkten) und ich musste den Barbier fragen, nachdem sein Werk beendet hatte, was das Ganze kostet. “Pay what you want“ (Bezahle das, was du, willst) lautete die etwas schwammige Preisangabe. Ich gab dem Meister einen Dollar, aber da verdunkelte sich seine Mine unmerklich, also legte ich einen Dollar drauf. Erst beim vierten Dollar lächelte er wieder.

Es gab immer wieder etwas zu entdecken. Mal eine Fischbraterei im Freien oder wir hier eine Bäckerei, die ihre gebackenen Fladen trocknete.

Auf dem Balkon standen kurz vorher dieser Aufnahme auch noch die Mutter und die älteste Tochter. Als ich mit Gesten fragte, ob ich Fotografieren dürfe, entschwand die Mutter, die große Tochter, die bis eben uns noch fröhlich zugewinkt hat, hinter sich herziehend.
Auf dem Rückweg zum Schiff, stolperten wir noch über einen Fischmarkt. Eigentlich ungewöhnlich, schließlich wurde es langsam dunkel und Fischmärkte werden in der Regel am frühen Morgen abgehalten.
Am Abend gab es am hinteren Außendeck noch eine Folkloreveranstaltungen. Allerdings habe ich selbige geschwänzt, so dass ich keine Fotos von den Bauchtänzen und sich drehenden Derwischen liedern kann. Um 23.00 Uhr legten wir ab.
133. Reisetag - Dienstag, 02.05.2017 Sharm El-Sheikh /Ägypten
Von der an der Westküste des Rotes Meers gelegenen Stadt Hurghada nach Scharm el-Sheik, das an der Ostküste an der Spitze der Sinai-Halbinsel liegt, sind es nur 57 Seemeilen (105 Km). Um 6.00 Uhr legten wir in einem recht trostlosen Hafen an und bereits um 7.00 ging der Badeausflug los. Gut, dass wir uns für den gestrigen Ausflug entschieden hatten, so konnten wir, wie gewohnt zwischen 7.00 und halb acht aufstehen. Die Aktion musste auch schon so früh starten, da wir bereits um 12.30 Uhr wieder ablegen wollten, d,h., dass man spätestens um zwölf Uhrzurück an Bord sein mussten.
Mit einem Shuttlebus bestand die Möglichkeit bequem und preiswert in die Stadt zu fahren. Da wir aber die Stadt schon einmal vor vier Jahren besucht hatten und wussten, dass sie vormittags wie ausgestorben ist, nutzen wir das Shuttleangebot nicht, sondern wollten nur mal unsere Nase kurz rausstrecken, ohne zu wissen, was uns erwartet
Wenige Gehminuten hinter dem von schwer bewaffneten Soldaten bewachte Hafenausgang lag ein Ferienanlage mit rustikalen Holzbungalows und eigenem Strand (Perience Golden Sand Beach). Das große eiserne Eingangstor war offen und neugierig, wie wir waren, gingen wir hindurch. Wir fragten, ob wir uns die Anlage ansehen dürften, was uns freundlich erlaubt wurde. Ein Gärtner mähte Rasen, ein anderer wässerte eine Grünanlage, was aber total fehlte waren Gäste. Ein Souvenirlädchen hatte geöffnet und der Inhaber versuchte vergeblich, uns etwas zu verkaufen.
Am Strandabschnitt mit den leeren Liegen kamen wir auf mit einem Ägypter ins Gespräch, der, wie sich herausstellte, diesen Strand nebst Liegen und Sonnenschirme betrieb. Auf unsere Frage, warum keine Gäste zu sehen, antwortete er, dass diese im Laufe des Vormittags noch kommen würden. Hotels, die keinen eigenen hätten, würden ihre Gäste mit Bussen hierhierbringen.
Obwohl wir keine Badeabsichten hatten (mangels mitgenommener Badesachen) konnte der Liegenvermieter ein kleines Geschäft mit uns machen. Er aktivierte auf seinem Smartphone eine App, die es zu einem Hotspot machte, sodass wir mit unseren Geräten ins Internet konnten.
Doris hatte gemeint, er macht das, weil wir uns so angeregt unterhalten hatten, aber wir mussten den Service natürlich bezahlen (5 $).
Wir verließen die Anlage, marschierten ein wenig weiter.
Jetzt reihten sich Strandbars und kleine Restaurants aneinander. Hier musste man entweder einen kleinen Eintrittspreis entrichten oder musste etwas verzehren. Jetzt tummelten sich auch einige Badegäste am Strand oder im Wasser.
An einer sehr gepflegten Anlage kehrten wir ein und tranken auf der Terrasse mit schöner Aussicht einen erfrischenden Lemmon -Minz-Juice. Hier hätte man prima baden können. Es war nicht überfüllt, aber auch nicht menschenleer.
Der Vormittag war ratzfatz vorbei und wir mussten zurück aufs Schiff.
Das eiserne Tor der Ferienanlage, wo wir zuerst mal reingeschaut hatten, war mittlerweile abgesperrt und natürlich hatten keine Busse Badegäste von anderen Hotels hierher gebracht. Der Tourismus in Ägypten geht am Stock.
Das verpasste Schwimmen im Meer kompensierten wir noch vor dem Mittagessen mit ein paar Schwimmzügen im Meerwasserpool der Artania. Bei 30 Grad Wassertemperatur war ein Verkühlen weitgehend ausgeschlossen.
Um 12.30 legten wir ab und erreichten gegen 23.00 Uhr unseren Ankerplatz vor Suez. Mit uns lagen hier noch weitere Schiffe. Am nächsten Morgen sollte die Passage durch den Kanal beginnen. Gefahren wird im Konvoi und die die Kanaladministration legt die Reihen folge fest. gegen 4.00 Uhr früh sollte es losgehen
134. Reisetag - Mittwoch, 03.05.2017 Suez Kanal und Port Said/Ägypten
Die Artania setze sich um 6.00 Uhr in Bewegung, vor uns fünf Schiffe hinter uns noch 14. Der Konvoi bewegte sich mit der vorgeschriebenen Geschwindigkeit von 10 Knoten, das sind 18,5 Km/Std. (1Knoten = 1 Seemeile/Stunde = 1,852 Km/Std). Der vorgeschriebene zeitliche Abstand zwischen je zwei Schiffen muss 15 Minuten betragen, damit beträgt der räumliche Abstand jeweils 4,6 Kilometer. Wer’s nicht glaubt, muss es selbst nachrechnen. ☺.
Der Skatbruder, der die Suezpassage vor einigen Tagen ein wenig geringgeschätzt hat, lag nicht zu 100% daneben. Die Landschaft links und rechts vom Kanal istkarg und wenig abwechslungsreich. Im Gegensatz zum Panamakanal gibtes keine Schleusen und Treidelloks und damit keine Technik, die begeistert.
Dafür ist der Suezkanal viel geschichtsträchtiger und mit fast 200 Kilometern ist er zweieinhalbmal länger als der Panamakanal mit seinen 80 Kilometern Länge.
Im Sechstagekrieg 1967 sperrte Israel den Kanal, der erst 1975 wieder für die Schifffahrt freigegeben wurden. Für 14 (zivile) Schiffe, darunter 2 deutsche bedeutet die Sperrung ein 8 jähriges „Festsitzen“, da sie sich zum Zeitpunkt der Sperrung im Kanal befanden und man sie nicht herausgelassen hat.
Während dieser Zeit befand sich immer eine Notbesatzung an Bord, die notwendige Wartungsarbeiten durchgeführt haben. Die Menschen durften also den Kanal „betreten“ und wieder verlassen, die Schiffe nicht. Unsinnige politische Willkür.

Es gibt nur 2 Brücken über den Kanal und eine Untertunnelung, ansonsten kann der Kanal nur mit Fähren überquert werden.

Da der Kanal nicht ständig unserer Aufmerksamkeit erfordertet, konnten wir auch mal den Pool nutzen ....

... und ich konnte zwischendurch mal schnell hier in meinem "Büro" ein Kapitel im Blog bearbeiten und dabei gleichzeitig das Ufer beobachten.

Wir verlassen hier den 2015 fertiggestellten neuen 37 Kilometer langen Kanalteil (linker Kanalarm). Der neue Kanal ermöglicht die gleichzeitige Passage der Schiffe in beide Richtungen
Am späten Nachmittag hatten wir den Kanal passiert und machten in Port Said fest.
Dabei handelte es sich um einen sogenannten technisch en Halt. Wir wollten nur die Passagiere wieder aufnehmen, die gestern zu einem Überlandausflug mit Übernachtung in Kairo angetreten waren.
Wir wurden im Vorfeld darüber informiert, dass wir das Schiff nicht verlassen dürften. Diese Maßnahme wurde insofern gelockert, dass die Behörden uns dann doch gestatteten von Bord zu gehen, allerdings durften und konnten wir das (eingezäunte) Gebiet um unsere Pier nicht verlassen.
An der Pier warteten schon ein Reihe von Händlern auf uns, die hier Ihre Stände aufgebaut hatten.
Da wir immer noch im Besitz von zwei Schokoladenosterhasen waren und unsere Betthupferlsammlung in Form von Schokoladentäfelchen, Schokoherzen etc. schon wieder stark angewachsen war, beschossen wir, diese Sachen irgendwelchen Kindern zu schenken.
Es gab nur zwei Probleme. Erstens sahen wir nirgends Kinder und wenn es außerhalb unserer Absperrung welche gegeben hätte, versperrte der engmaschige Zaun eine Übergabe.
Etwas weiter abseits von Schiff und Verkaufstrubel fanden wir dann zumindest einen Jugendlichen und ein Loch im Zaun, sodass die eine Hasenübergabe erfolgen konnte.
Eine Polizistin und ein Polizist, die in der Nähe jenseits des Zauns selbigen bewachten, kamen misstrauisch näher und fragten uns etwas, was wir nicht verstanden. Als Antwort reichten wir ihnen zwei Schokoladenherzen (20g/Herz) mit der Aufschrift „PHOENIX - Willkommen zu Hause“. Damit waren die Formalitäten erledigt und sie zogen sich wieder zurück.
Mittlerweile drängten sich 5 -6 ziemlich armselig gekleidete Menschen darunter eine Frau, wahrscheinlich Obdachlose an den Zaun und hielten uns ihre offenen Hände entgegen. Wir konnten jedem einige Täfelchen durch den Zaun stecken, dann war unser Vorrat verbraucht. Die Frau und die Männer schienen sich über die Schokolade zu freuen.
Als wir uns wieder Richtung Schiff bewegten, winkten uns Polizistin und Polizist fröhlich zu.
135. Reisetag - Donnerstag, 04.05.2017 Seetag
Doris war heute im Frisiersalon an Bord. Das ist an sich nichts Besonderes und erwähnenswert. Es ist auch immer noch nichts Besonderes, wenn auch gleichzeitig der Kapitän im benachbarten „Behandlungsstuhl“ die Haare geschnitten bekommt. Etwas Besonderes war es aber, als eine Dame, die im Moment von einer Brückenführung gekommen war, wo der Kapitän gerade nicht Dienst tat, denn er saß ja beim Friseur. Der nun unerwartet gesichteten Schiffführer wurde mit dem Jubelschrei: “DA IST ER JA“ bedacht und ungefragt in seinem Friseurumhang fotografiert. Dass sie die Friseurin, die dabei zwangsläufig und störenderweise mit aufs Bild kam, nicht vorher zur Seite geschubst hat zeugt doch von den guten Umgangsformen der fotografierenden Dame.

Schatten- und windgeschützte Plätze am Pool sind sehr begehrt. man darf nicht meinen, dass die Nutzer der leeren Liegen sich gerade alle im Pool befinden. Die Reserviererei ist einfach eine Unsitte und sorgt für eine Knappheit, die es so eigentlich gar nicht geben müsste.
Am Abend kam der Maitre (Restaurantchef wegen) der Geschichte mit unserer verkorksten Schnitzel- und Burgerbestellung vor einigen Tagen auf uns zu.
Er bot uns, wie schon am Sonntag der Hoteldirektor auch, eine Flasche Wein an. Aber wir erklärten erneut, dass wir uns nicht beschwert haben, um Freibier zu erhalten, sondern wollten lediglich bei künftigen Bestellungen einfach keinen Stress mehr haben.
Ein erneutes Angebot seinerseits war, dass wir uns für morgen Abend im Lido etwas Besonderes zum Essen wünschen dürften, was dann neben dem normalen Tagesmenüs extra nur für uns zubereitet würde. Wir stimmten zu und er ließ uns zwischen Steak, Schnitzel und Hamburger wählen. Wir entschieden uns für Schnitzel (die gab es als Tagesmenü während der gesamten Weltreise erst zwei oder dreimal). Und die Krönung des Sondermenüs sollten Pommes Frites sein, die es auch äußerst selten gab.
Das morgige Abendessen versprach gut zu werden.
135. Reisetag - Freitag, 05.05.2017 Souda Bay (Chania)/Kreta/Griechenland
Der Hafen in der Bucht von Souda ist Fährhafen und Marinestützpunkt. Hier machten wir am Morgen fest.
Mit einem Linienbus, der alle 10 Minuten vom Hafen abfährt, gelangten wir schnell und preiswert ins Zentrum von Chania, eine Stadt mit 110.000 Einwohnern, etwa 6,5 Kilometer von Souda entfernt. Chania war bis 1971 die Hauptstadt Kretas wurde dann aber von Heraklion abgelöst.
Direkt an der Bushaltestelle befindet sich eine kreuzförmige klassizistische Markthalle.
Angeboten werden hier Schafs- und Ziegenkäse, Olivenöl, Seifen. Lederwaren und Souvenirartikel, ein Angebot, das sich weitestgehend an die Touristen richten, vielleicht mit Ausnahme der Frischfleischhändler.
Schöne war, dass man hier nicht mehr zu handeln brauchte und man mit dem Euro bezahlte. Unschön war, dass dies das baldige Ende der Reise signalisierte.
Interessant war, dass es hier die absolut gleichen, leichten, bedruckten Baumwollhosen wie in Indonesien gab, wo wir ja auch fleißig eingekauft hatten. Dort zahlte man für die Hose je nach Verhandlungsgeschick zwischen 5 und 8 US-Dollar (4,50€ bis 7,20€), während man hier ordentliche 16€ bis 18€ hinlegen musste, Hätten wir eine genügend große Anzahl Hosen in Indonesien gekauft (ca. 3.800 Stück), hätten sich die Reisekosten für uns beide durch die Ersparnis locker amortisiert.
Auf unserem Weg zum nahegelegenen alten Hafen, der als Yachthafen und Hafen für Ausflugsboote genutzt wird, kamen wir an einem Sportgeschäft vorbei, in dessen Schaufenster eine Kopie des Pokals für die Fußball-Europameisterschaft, die die Griechen ja 2004 gewonnen hatten (1:0 gegen Portugal; Trainer Otto Rehhagel!).
Da Neugier des Touristen erste Bürgerpflicht ist, betraten wir den Laden.

Stolz präsentierte uns das "wandelnde Fußballlexikon" das Trikot der deutschen WM-Elf mit sämtlichen Unterschriften
Es stellte sich sehr schnell heraus, dass dies gar kein Sportgeschäft für Fußballtrikots ist, sondern ein privates Fußballmuseum mit diversen Exponaten sowohl den griechischen Fußball, als auch den internationalen Fußball bezüglich EM und WM betreffend.
Der Museumsleiter selbst, ein wandelndes Fußballlexikon, erklärte uns, dass er vom griechischen Fußballbund explizit zum Betreiben des Museums autorisiert worden.
Und der Pokal für die Europameisterschaft war übrigens keine Nachbildung, sondern das Original.
Aber wieso ist er jetzt im Besitz des griechischen Fußballverbands?
Falls es jemand weiß, möge er doch bitte die Erklärung im Gästebuch hinterlassen. Vielen Dank schon mal dafür.
Wir bewunderten diverse originale Trikots, meist mit Autogramm von deutschen und internationalen Stars und natürlich das des Torschützen des Siegtores im Finale 2004 gegen Portugal - Angelos Charisteas. Unser Wandelndes Fußballlexikon wusste zu jedem Teil etwas zu erzählen.
„Chania malerischer Naturhafen wird von einer wunderschönen Uferpromenade gesäumt“ wusste der Reiseführer zu berichten. Vom Fußballmuseum bis dorthin war es nicht sehr weit. Der östliche Teil des Hafens war wirklich recht malerisch. Spazierte man aber ein kleines Stück westwärts, kam man an eine Bucht an deren Uferpromenade in unseren Augen gar so schön war, wie der Reiseführer versprochen hatte. Der Umfang der Bucht beträgt etwa einen Kilometer und an der dortigen Uferpromenade reiht sich über die gesamte Länge Lokal an Lokal und Restaurant an Restaurant und sonst nichts anderes, alle mit Außenterrasse und jedes gut besucht.
Also machten wir auf dem Absatz kehrt und fanden in einer kleinen Seitenstraße ein gemütliches Bistro, wo wir Pause machten.

Das Kutschpferd steuerte zielsicher diese Kneipe an, weil es wusste, dass der Wirt ein Leckerli bereithält
Über den Rest unserer Tour durch Chania gibt es nicht viel zu berichten. Das Gebiet zwischen Markthalle und altem Hafen ist weitgehend touristisch geprägt, das heißt viele Geschäft e mit den Urlaubern und Tagesbesuchern als Zielgruppe. Die Häufung dieser Geschäfte ist durchaus ähnlich den Basaren, die wir z. B. in Dubai oder Salalah besucht hatten.

Im Hintergrund zu erkennen: Der bis zu 2400 Meter hohe Gebirgszug der" Weißen Berge" (Lefka Ori). Wir dachten zunächst, die Berge seien mit Schnee bedeckt, aber das Weiß ist kristalliner Kalkstein.
Zurück an Bord, nach dem Ablegen standen wir noch lange an der Reling und ließen die Küste von Kreta an und vorbeiziehen.
Für das Abendessen sollten wir ja außer der Reihe eines der seltensten Menüs bekommen, nämlich Schnitzel mit Pommes, während der Rest der Passagiere sich mit den manchmal abenteuerlichen Kreationen des Schiffkochs abmühen musste.
Auf einem Pult am Restauranteingang ist immer die aktuelle Menükarte Ausgelegt; auf die wir auch heute rein interessenhalber einen Blick warfen und trauten unseren Augen nicht - es gab Schnitzel, allerdings nur mit Petersilienkartoffeln.
Also holten wir uns unser Schnitzel, wie jeder andere auch, am Buffet ab. Der Oberkellner kam an unserem Tisch und fragte ernsthaft, ob er uns jetzt das „Sonderschnitzel“ bringen solle, allerdings würde es sich durch nichts von all den anderen Schnitzeln unterscheiden. Das machte natürlich wenig Sinn, aber an den Pommes Frites waren wir nach wie vor interessiert. Von dieser Sonderlocke wusste der Oberkellner allerdings nichts. Also aßen wir, wie jeder andere Passagier auch, als Beilage Petersilienkartoffeln.
Wo bitte ist die versteckte Kamera? Wird hier eine Doku-Soap für RTL2 gedreht?
136. Reisetag - Samstag, 06.05.2017 Seetag
Wir erfahren, dass ein sehr nettes Ehepaar, das wir kennengelernt haben und ebenfalls die gesamte Weltreise mitmachten, musste gestern die Reise abbrechen, weil der Mann plötzlich erkrankte und auf Kreta in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.
Wir hoffen, dass er das Hospital bald wieder verlassen kann und beide bald nach Hause in Falkensee zurück können.
Auf diesem Weg alles Gute.
Der letzte Seetag vor dem Ende einer Etappe wird in der Regel der Tag der Abschiedsgala genutzt, so auch heute.
Der Ablauf ist immer gleich:
- 11.00 Uhr Stadl-Frühschoppen in der Kopernikusbar (wetterabhängig)
- 17.30 Abschiedscocktail mit Kapitän und Reiseleitung
- ab 18.00 Uhr Gala Abendessen
- 22:30 Latenightsnack in Harry’s Bar: Currywurst in 3 Schärfen

Am Rücken des Polo-Hemds sind alle 78 angnelaufenen Häfen aufgelistet. Das sieht ein wenig so aus wie ein Helene-Fischer-Tour-2016-Shirt.
Phoenix hat für jeden, der die gesamte Reise mitgemacht hat, ein T-Shirt anfertigen lassen. Meines passt mir gut (Größe L, obwohl ich normal mit M auskomme), das von Doris (M) passt nicht. Deshalb hat sie es an unseren Kabinensteward geschenkt.
Zu welchen Anlass zieht man so ein Shirt eigentlich an? Mir fällt im Moment keiner ein, es sei denn, man will der Welt mitteilen: „Seht mal her, ich habe eine Weltreise gemacht“. Das habe ich nicht mehr nötig, denn dafür habe ich ja diesen Blog. ☺
Außerdem haben wir unser Bordbuch zurückbekommen. Ein Bordbuch ist ein einem Reisepass nachempfundenes Büchlein, in das die Reiseleitung jede Kreuzfahrt bzw. jede Etappe per Stempel oder Aufkleber „dokumentiert“ und mit Unterschrift vom Kapitän und Kreuzfahrtdirektor versehen lässt.
137. Reisetag - Sonntag, 07.05.2017 Dubrovnik/Kroatien
„An dem halben Tag, an dem wir in Dubrovnik liegen, bleiben wir an Bord“ war unsere Planung, denn
- Der Wetterbericht sagte Regen voraus,
- es ist Sonntag,
- wir müssen packen
- um 13 Uhr legen wir schon wieder ab
- wir waren schon zweimal in Dubrovnik
Langer rede kurzer Sinn, wir waren dann doch in der Altstadt von Dubrovnik, der Perle der Adria. Zum einen hatten wir den ganz großen 30-Kg-Koffer, der mit dem Gepäckservice Tefra von Venedig direkt nach Eschborn/Niederhöchstadt gebracht wird, bereits gestern fertig gepackt.
Auch am Sonntag lohnt sich ein Besuch und so schlecht sah das Wetter gar nicht aus.
Phoenix hat einen Shuttlebus bereitgestellt, den wir um 9.00 Uhr problemlos nutzen konnten und uns so Erforschung des Fahrplans des Linienbusses erspart geblieben ist.
Mehr durch Zufall entdeckten wir an der nördlichen Stadtmauer die Verkaufsstelle für die Tickets der Gondelbahn. Die Talstation befindet sich außerhalb der historischen Stadtmauer und war in wenigen Minuten erreicht. Nach knapp 5 Minuten waren wir oben auf der Bergstation und hatten eine tolle Sicht auf die Stadt.
Wieder unten im touristischen Getümmel machten wir uns auf die Sache nach dem kleinen Marktplatz, wo wir vor einigen Jahren schon einmal Lavendelöl gekauft hatten, das von einer solcher hervorragender Qualität war, wie wir sie bei späteren Käufen ob auf dem Jahrmarkt oder während anderer Urlaube nie mehr bekommen haben.
Den Marktplatz mit den Tischen, an denen Frauen Lavendelprodukte haben wir auch gefunden und das Öl, welches wir gekauft hatten, erwies sich bei einem ersten Test in der Kabine wiederum als hervorragend.
Um 12 Uhr waren wir wieder auf dem Schiff zurück und um 13 Uhr hieß es zum letzten Mal „Leinen los“ und wir nahmen Kurs auf Venedig.
Der Nachmittag war weitestgehend mit Kofferpacken ausgefüllt. Erst packte Doris ihre zwei Koffer und dann ich meine Beiden.
Zum Abendessen hatten Küche und Service die Sensation geschafft. Doris und ich bekamen Schnitzel mit Pommes Frites.
138. Reisetag - Montag, 08.05.2017 Venedig/Italien
Heute mussten wir ein wenig früher aufstehen, denn die Kabinen mussten bis spätestens 9.00 Uhr geräumt sein.
Noch während des Frühstücks meldete sich unser Kreuzfahrtdirektor über Bordlautsprecher, das wegen des starken Nebels der Hafen von Venedig gesperrt ist. Wir mussten also erst einmal ankern und warten bis sich der gelegt hatte. Mit knapp zweistündiger Verspätung liefen wir in den Canale Grande ein. Der Restnebel sorgte dafür, dass die Freude der Fotografen an den Motiven wie Seufzerbrücke oder Markusdom im wahrsten Sinne des Wortes getrübt war.
Die verspätete Ankunft sorgte dafür, dass die Flüge nach München und Düsseldorf nicht mehr erreicht werden konnten und die Leute irgendwie umgebucht werden mussten.
Unser Flug war nicht betroffen, da er erst um 18:15 Uhr gehen sollte. Koffer wurden bereits in der Nacht eingesammelt und wurden nach dem Anlegen in einer Halle artendeponiert, sortiert nach Flügen anhand farbiger Einsteckkärtchen.
Man hatte uns schon angedroht, dass der italienische Zoll darauf besteht, dass man die Koffer identifizieren.
Dass schließlich die Identifikation des Gepäcks durch die kongeniale Zusammenarbeit vom italienischen Zoll und Phoenix mit fast 2 Stunden Schlange stehen und erneuter Gepäcksortierung verbunden war, war für uns eine völlig neue Erfahrung. Solche Sicherheitsmaßnahmen gehen, wenn vernünftig organisiert, eigentlich relativ schnell über die Bühne.
Am Flughafen beim Einchecken war natürlich erneut Geduld gefordert, aber das ist ja auf allen Flughäfen in der Welt ähnlich - zu viele Fluggäste, zu wenige Schalter.

Der Willkommensgruß von unseren Nachbarn aus dem 2. Stock, die sich auch um unsere Post gekümmert haben.
Der Heimflug war problemlos und fast pünktlich, sodass wir gegen 21.00 Uhr wieder zu Hause waren
So, damit ist dieser Reiseblog nun zu Ende.
Das Gästebuch bleibt aber nach wie vor offen und ich freue mich nach wie vor über jeden Eintrag.
Ich war erstaunt, dass die Schilderungen der doch sehr persönlichen Eindrücke, Erlebnisse und die subjektive Bewertung derselben auf relativ großes Interesse gestoßen ist, wie auch der Besucherzähler auf meiner Internetseite anzeigt.
Ich fand es toll, einige der Leser auf der Artania persönlich kennengelernt zu haben, manche nur flüchtig andere näher. Und auch die erhaltenen Mails und die Einträge im Gästebuch waren natürlich ein Ansporn, die Berichterstattung nicht zu vernachlässigen, auch wenn das doch ein ordentliches Stück Arbeit gewesen ist, aber eine Arbeit die mir Spaß und Freude bereitet hat.
Und das Ergebnis, der doch recht umfangreich gewordenen Blog, wird von Doris und mir in der Zukunft immer wieder als „Nachschlagewerk“ verwendet werden, wenn wir uns an Orte oder Erlebnisse noch einmal erinnern möchten.
Die nächste gro0e Reise ist auch schon unter Dach und Fach - Dezember 2017 bis April 2018. Das klingt vielleicht ein wenig übertrieben, aber unsere Überlegung ist die, solche Reisen jetzt zu machen, wo man noch relativ fit ist und bei den Landgängen noch einiges unternehmen kann und nicht ausschließlich auf die von Phoenix organisierten und durchgeführten Ausflüge im Pulk der Masse mitmachen zu müssen.
Es wird auch wieder einen Blog geben, die entsprechende Internetseite existiert sogar schon und kann aufgerufen werden, auch wenn sie zunächst nur grob zusammengeschustert worden ist und außer der Routenbeschreibung noch nichts weiter drinnen steht.
In diesem Sinne
Auf Wiedersehen bzw. Auf Wiederlesen